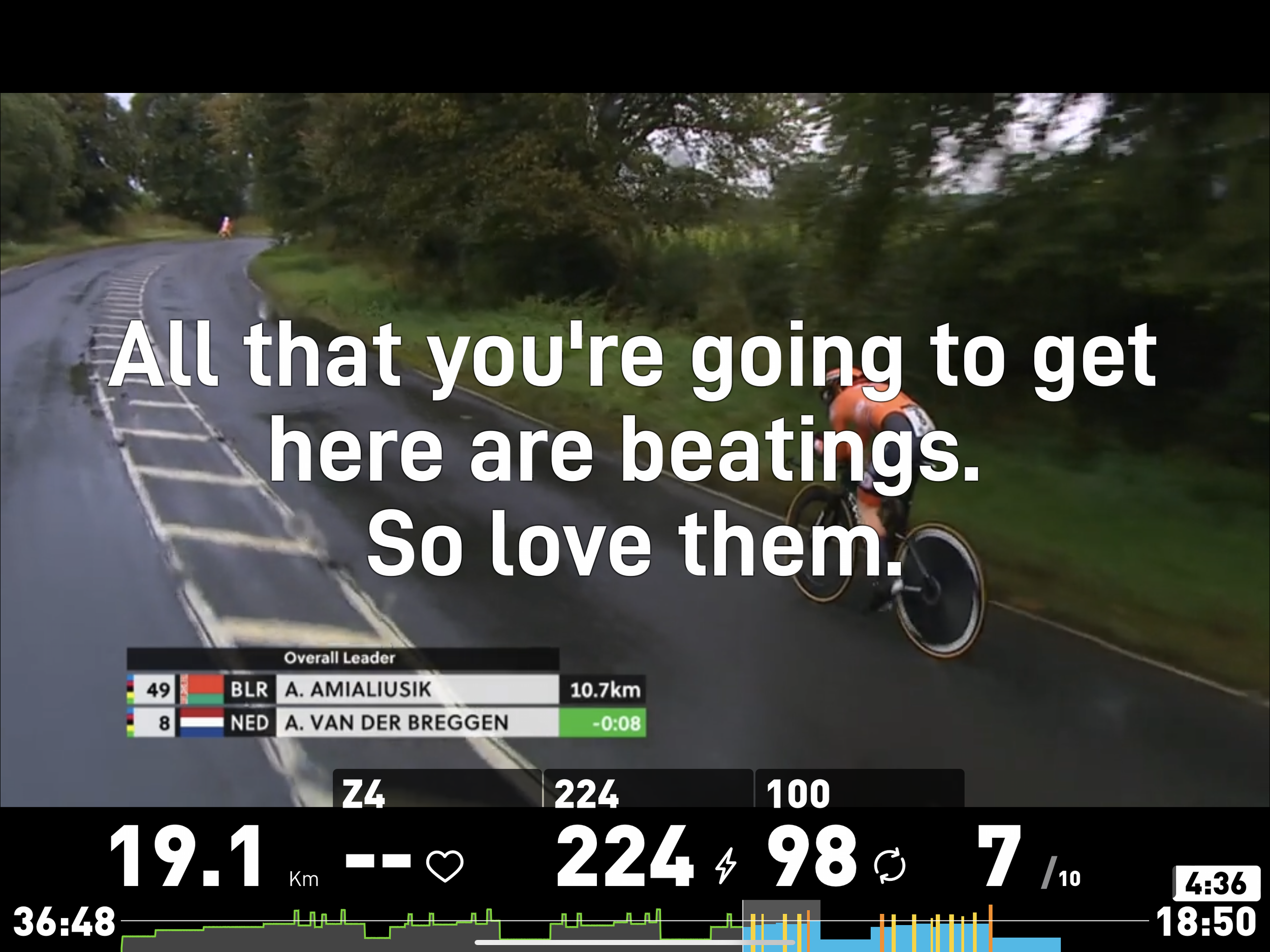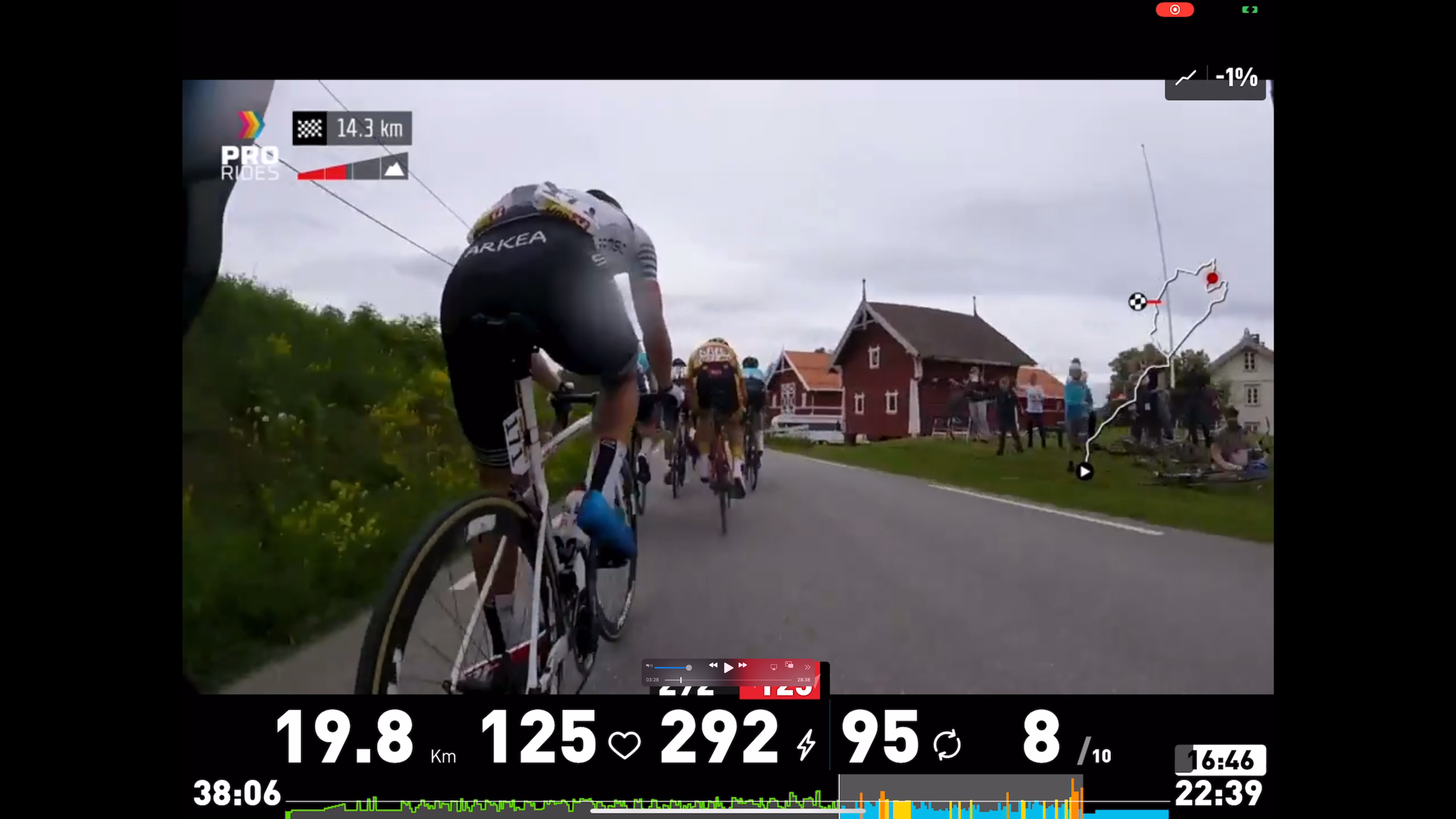Seit drei Jahren gibt es in unserem Haushalt ein Lastenrad - genauer: ein Urban Arrow Family. Und es war eine der besten Anschaffungen der letzten Jahre! Sei es als anfängliches Corona-Lockdown-Kinderunterhaltungsvehikel, als tatsächliches Transportgerät oder als fast schon Auto-Ersatz vom Einkauf bis zum Wochenendausflug. Beim Kauf und bei der Auswahl des Rades habe ich sehr viel recherchiert - immerhin gibt es unterschiedliche Bauformen, Fabrikate und Hersteller, und da gibt es jeweils Eigenheiten und Spezialitäten, die es zu beachten gilt. Ebenfalls nach drei Jahren ist nunmehr die Behaltefrist des Rads abgelaufen, die sich aus der Förderung ergibt, die ich bei der Anschaffung lukrieren konnte. Zeit also auch für ein Fazit, wie sich das Rad in drei Jahren intensiver Nutzung geschlagen hat.
Durch die kürzeste Nacht des Jahres! (mit ein paar Tipps für Nachtfahrten)
Am 21.6. - dem längsten Tag des Jahres - habe ich schon einige Male eine Fahrt in den Sonnenuntergang organisiert, um die Sommersonnenwende zu feiern. Diesmal aber geht es um die kürzeste Nacht! Naja gut, ich habe geschummelt und bin erst am Wochenende darauf gefahren - man möchte ja nicht unter der Woche völlig fertig und übernachten im Büro hängen. From Dusk till Dawn also - von Sonnenuntergang bus Sonnenaufgang. Konkret sind das gut 7,5 Stunden, von kurz nach 21:00 bis knapp vor 5:00. Ich habe mir eine ruhige und verkehrsarme Route ausgesucht, meine Vorräte aufgefüllt, die Lampen montiert und schon geht es alleine durch die Nacht. Und das ist etwas besonderes, wirkt in der Dunkelheit doch alles irgendwie anders - die Geräusche, die man hört, die Kurven, die man geglaubt hat zu kennen und alles, was so im eigenen Kopf vorgeht.
Mein neues Licht- und Powersetup fürs Bikepacking (SON-Nabendynamo, Sinewave Beacon-Frontlicht)
Wer beim Bikepacking auch in die Nacht fahren will und bei der Stromversorgung etwas unabhängiger von Steckdosen und Powerbanks werden möchte, kommt früher oder später nicht an einem Laufrad mit Nabendynamo und dazugehörigem Licht vorbei. Ich habe mit von Sorins kundigen Händen bei PBIKE ein Laufrad mit SON-Nabendynamo einspeichen lassen, hatte nach langer Recherche (und noch viel längerer Wartezeit) ein Vorderlicht von Sinewave in Händen und wiederum Sorin hat sich um die fachmännische Installation gekümmert. (Bei all den Steckern, Kabeln, Verlängerungen, Adaptern, Lötstellen und Zugführungen wollte ich nicht hineinfunken!). Aber seht selbst...!
Optische Radbrillen - Technik, Optik, Modelle und Alternativen
Das Thema Optische Sportbrillen mag nicht das Riesenthema sein, mit dem man die Massen begeistern kann. Aber jene, die es betrifft, wissen davon ein Lied zu singen, wie schwierig es sein kann, die richtige Lösung fürs Radfahren zu finden. Alltagsbrillen eignen sich nur beschränkt für die Radtour, Kontaktlinsen können in der Handhabung etwas tricky sein (zumindest für mich), Lasern ist keine Option und bei optischen Brillen für den Sport gibt es unzählige Systeme, Technologien und Dinge, die man beachten muss.
Ich habe in den letzten Jahren viele Dinge ausprobieren und getestet und möchte nun meine Erfahrungen mit euch teilen. Was hat gut funktioniert, was weniger gut, wo bin ich gescheitert und wo bin ich am Ende des Tages gelandet. Ich versuche euch die unterschiedlichen Systeme an Sportbrillen zu erklären (Clip-In, Adapterverglasung und Direktverglasung), gehe auf die Werte ein, die man vor der Bestellung einer solchen bRillen wissen sollte und zeige euch ein paar jener Modelle, mit denen ich derzeit auf dem Rad (und auch abseits) unterwegs bin.
Link zu Evil Eye:
Link zu den Optikern meines Vertrauens:
https://roland-bischel.at
http://www.rusteroptik.stadtausstellu...
1x1 - Auflieger und Aero-Bars
Beim Race Around Austria Mitte August hab ich mit einigen Leuten über meine Challenge-Teilnahme 2020 geplaudert und wurde unter anderem gefragt, was ich an meinem Setup zu damals ändern würde. Schnelle Antwort: Auflieger! Und es klingt heute fast etwas merkwürdig, aber irgendwie waren Auflieger vor zwei Jahren noch kein so großes Thema. Es gab Zeitfahrer und Rennräder und nur die wenigsten haben sich auf ihren Renner Aero Bars montiert. Erst mit dem Boom von (soften) Ultra-Events, dem Aufkommen von Gravel-Endurance-Events und Bikepacking auf langen Strecken sind Auflieger in der Masse angekommen. Und heute wird man entlang der Donau nicht (oder zumindest seltener) schief angeschaut, wenn man am Rennradlenker noch extra Fühler montiert hat. Und sogar am Gravelbike sind Auflieger angekommen, auch wenn dort der Einsatzbereich noch etwas spezifischer ist.
Wozu das Ganze?
Klar, vom Zeitfahrer kommend geht es um Geschwindigkeit und geringen Luftwiderstand. Auflieger bringen den Oberkörper nach unten, die Arme nach vorne und die Schultern zusammen – die Angriffsfläche für den fiesen Wind von vorne wird geringer, die Geschwindigkeit steigt. Wer schon einmal auf einem Zeitfahrer gesessen ist, wird wissen wie toll es sich anfühlt, wenn man ohne viel Anstrengung mit 35 oder 40 km/h dahingleitet. Zur besseren Aerodynamik kommt allerdings noch ein zweiter ganz wesentlicher Effekt hinzu, der für mich persönlich noch weit wertvoller ist, als die Aero-Geschichte: die zusätzliche (Griff)Position. Besonders auf langen oder mehrtägigen Touren ist es Gold wert, eine zusätzliche Position am Rad zur Verfügung zu haben, um die Belastung für Körper und Gelenke zu reduzieren oder besser zu verteilen.
Wie funktionierts?
Wer sich auf die Suche nach Extensions macht, wird im Internet als erstes überwältigt von einer schwer überschaubaren Menge an Bauformen, Längen und Biegungen. Am einfachsten sind drei Hauptgruppen zu unterscheiden:
„klassische“ Auflieger, wo zwei voneinander getrennte Rohre nach vorne zeigen,
Aero-Bars, die auf irgendeine Art miteinander verbunden sind, ein „U“ oder Viereck bilden und mindestens die gleichen Positionen erlauben wie klassische Auflieger und
Sonderformen wie die Aero Bars von „Ride Farr“, die eher nur eine Erweiterung der Griffpositionen am Lenker sind und nicht den vollen Funktionsumfang von Aufliegern bieten.
Säumen wir das Pferd von hinten auf: Die dritte Gruppe - kleine Aero Bars oder Aufsätze – bieten im Normalfall eine oder mehrere zusätzliche Griffpositionen. Hände und Oberkörper gehen dadurch nicht so weit nach vorne bzw. unten – damit ist der aerodynamische Vorteil nicht so groß. Gruppe 2 („nicht-klassische“ Auflieger) sind auf den ersten Blick manchmal etwas einschüchternd, weiß man doch oft nicht, wo hinten und vorne, oben und unten ist. Die Holme sind dabei oft speziell geformt, sodass sich rein aus der Optik der Modelle nicht immer ergibt, welche Eigenschaften und Vorteile die Auflieger genau mitbringen. Kern ist in meinen Augen die Frage, wie lange die Holme nach vorne gehen und damit eine Auflieger-Position erreicht werden kann. Auf Nummer Sicher geht man hingegen mit der ersten Gruppe, den klassischen Aufliegern mit zwei parallelen Holmen, wie man sie im Endeffekt vom Zeitfahrer kennt. Aber auch hier steckt der Teufel im Detail, findet man doch alles von „I“-Form über „J“-Form und diversen „S“-Biegungen. Die Buchstaben beschreiben dabei einfach die Form der Holme und geben damit einen Hinweis auf die mögliche Position am Rad. Ein „I“-förmiger Holm wird dabei den Körper am weitesten nach vorne zwingen, ein „J“ oder „L“ hingegen erlaubt etwas mehr Komfort. Mehrfach Biegungen erlauben außerdem unterschiedliche Griffpositionen. Vom Anschauen im Internet wird man hier leider nur selten richtig schlau und Ausprobieren im Fahrradgeschäft geht auch nicht auf die Schnelle. Wer seinen Körper und seine Möglichkeiten (und Limits!) kennt, ist hier jedenfalls im Vorteil, ansonsten muss man sich tatsächlich einfach herantasten. Oder natürlich Freunde fragen, ob man sich die Auflieger schnell mal für eine Proberunde ausborgen kann.
Die verfügbaren Modelle unterscheiden sich außerdem nach ihren Verstell- und Individualisierungsmöglichkeiten. Dies betrifft vor allem die Einstellung der Arm-Pads. Diese sind insofern sehr wichtig, als sie das Hauptgewicht der Last tragen und einen entsprechenden Komfort in der richtigen Position bieten sollen. Dazu kann man diese in der Regel sowohl seitlich als auch der Länge nach mittels Schrauben verschieben. Bessere Modelle bieten hier meistens einen größeren Einstell-Bereich.
Die nächste Hürde ist die Montage am Lenker. Auch hier lohnt sich ein genauer Blick auf das Modell und den Lieferumfang. Positionen auf dem Rad sind eine individuelle Angelegenheit und auch - oder gerade mit – Aufliegern sei auch hier auf die Sinnhaftigkeit eines Bikefittings hingewiesen. Auflieger am Rennrad sind jedoch was anderes als Auflieger am Zeitfahrer. Am TT-Bike ist die Sitzposition eine andere und die Hüfte ist offener, wodurch man mit dem Oberkörper und den Armen eine tiefere Position fahren kann. Auf dem Rennrad ist der Sattel weiter hinten, die Hüfte damit mehr gebeugt und eine allzu tiefe Montage der Extensions wird den Hüftbeuger an seine Grenzen bringen. Praktisch daher, wenn bei den gekauften Extensions Spacer dabei sind, mit deren Hilfe man das ganze Setup etwas nach oben bringen kann, ohne sich gleich den ganzen Lenker umdrehen zu müssen. Und wer längere Touren unternehmen möchte, wird ohnehin nicht die ultra-sportliche Position als oberste Prämisse haben.
Der Blick auf die Produktliste ausgewählter Auflieger zeigt außerdem ein großes Preisgefälle zwischen Aluminium- oder Carbon-Extensions. Erstere bewegen sich irgendwo rund um die 100-150 Euro, während der Kohlenstoff einen weitaus tieferen Griff in die Geldbörse bedingt (ab 250 Euro – nach oben offen; Custom 3D-Drucke kommen bei 2-3000 Euro zu liegen). Es kann sein, dass ich ein unschlagbares Argument FÜR Carbon übersehe, ansonsten sehe ich allerdings keinen Grund, warum man nicht zu einem Alu-Modell greifen sollte. Der Gewichtsunterschied ist in meinen Augen vernachlässigbar.
Bei der Montage am Lenker sind neben den Fitting-Aspekten auch technische und „logistische“ zu beachten. Zum Beispiel sollte man bei Carbon-Lenkern tunlichst das maximal zulässige Drehmoment beachten. Mich persönlich ärgert oder verwundert etwas, dass durch den Einsatz von integrierten Vorbau-Lenker-Kombinationen bei vielen Herstellern keine Extensions montiert werden können. Die dabei verbauten Teile sind fast immer oval oder abgeflacht und erlauben daher keine Montage von klassischen Aufliegern. Ebenso sollte man sich darüber in Klaren sein, wie man sein Cockpit organisieren möchte. Ein Radcomputer mit klassischem Front-Mount geht sich mit Auflieger eventuell nicht mehr aus. In diesem Fall muss in den meisten Fällen eine neue Halterung für die Montage direkt an den Extensions her. Und wer an längere Touren und Bikepacking denkt, muss sich auch im Klaren sein, dass sich die Schlaufen von Lenkertaschen meistens genau an jener Position des Lenkers befinden, wo jetzt die Extensions angeschraubt sind. (Hier gibt es auf der anderen Seite aber sehr praktische und funktionale Taschen, die an den Extensions montiert werden – zB von Cyclite).
Oben ist es schon einmal erwähnt, hier kommt es nochmal – weil es wichtig ist. ;) Gerade wenn man länger oder schneller fahren möchte, lohnt es sich, mit einem Profi gemeinsam die Sitzposition und mögliche Einstellungen im Rahmen eines Bikefittings zu diskutieren. Wie bei allen Einstellungen wird sich auch bei Extensions erst nach einigen Kilometern herauskristallisieren, was gut oder weniger gut funktioniert. Aber eine vernünftige Ausgangsposition lässt sich mit einem Fitting jedenfalls definieren.
Ebenfalls erst an die Position gewöhnen müssen, wird sich der Körper. Wer – wie ich (mea maxima culpa, ich weiß… ) – wenig bis kein Augenmerk auf die Oberkörper- und Nackenmuskulatur legt, wird dies mit Extensions doppelt und dreifach spüren. Die Position auf den Aufliegern spricht nun einmal andere Muskelpartien an, und diese zu trainieren und bei Laune zu halten, fördert nachhaltig die Freude am Radfahren. Bringt ja nichts, in der Aero-Position 5 Watt zu sparen, wenn man diese Position dann nur 2 Minuten halten kann…
Bremsen und Schalten sind Dinge, die mit Extensions etwas Umdenken und Aufmerksamkeit erfordern. Technisch gesehen hat die oder der einen Vorteil, die oder der eine elektronische Schaltung am Rad montiert hat, die sich mit sogenannten „Blips“ oder zuschaltbaren Fernsteuerungen ergänzen lässt. Mit solchen an den Enden der Extensions kann man auch in der geduckten Position frisch und fröhlich drauf los schalten. Ale anderen müssen zum Schalten umgreifen auf die Hoods. Gleiches gilt – unabhängig vom Schaltsystem – für die Bremsen! Und da für das Reagieren, Umgreifen auf die Hoods und Betätigen der Bremsen etwas Zeit notwendig ist, sind Extensions in Gruppenfahrten oder auf bestimmten Streckenabschnitten nicht allzu empfehlenswert. Denn mit einem Sturz ist zweifellos jeder Aerodynamik- oder Komfortgewinn obsolet.
Fazit
Auflieger oder Extensions sind als aerodynamische Optimierung und als Komfortgewinn eine sinnvolle Anschaffung, wenn man denn einen Einsatzbereich für sich sieht. Ich habe die Auflieger sowohl am Gravelbike als auch am (Komfort)Rennrad als angenehmes Extra schätzen gelernt – mehr als Komfortgewinn und zusätzliche Griffposition denn als Optimierung der Aerodynamik. Ich gerate bei zu niedriger Montage an meine muskuläre Grenze und habe daher die Überhöhung meines Lenkers stark reduziert. Wichtig ist, die richtige Form für die eigenen Bedürfnisse zu finden – leider ist ein Ausprobieren von unterschiedlichen Modellen de facto nicht möglich. Ich bin am Ende bei Zipp-Aluminium-Extension gelandet, die auch etwas höher bauen und damit ein Greifen des Oberlenkers ohne Einschränkungen erlauben. Und am Wichtigsten: Man kann einen Pizza-Karton drauflegen!
Wahoo Systm (nach 6 Monaten Einsatz)
Wenn man etwas über einen längeren Zeitraum für einen Blogbeitrag testen möchte, kann es mitunter passieren, dass man überholt wird – von der Realität, vom Zeitplan oder von Neuerungen. So geschehen bei meinem Test von Wahoo Systm. Wobei die Inhalte, über die ich schreiben möchte, deswegen nicht alt oder überholt sind und sich ja eigentlich nichts Grundlegendes an der App geändert hat, seit ich begonnen habe, sie zu benützen.
Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wahoo – bisher in erster Linie als Hersteller von Rollentrainern bekannt – hat neben SYSTM (das auf dem von Wahoo gekauften „Sufferfest“ beruht) auch noch „RGT Cycling“ in sein Portfolio aufgenommen. Und während hier also Wahoo einen Schritt vom Gerätehersteller zum Gesamtanbieter macht, bastelt dem Vernehmen nach parallel dazu der Softwareanbieter Zwift an seinem ersten Smart Trainer, möchte also von der Softwarebude auch zum Gesamtanbieter werden (nur von der anderen Richtung halt). Es werden hier also spannende Zeiten auf uns zukommen und idealerweise profitieren die Endkundin und der Endkunde ja auch von solchen – hoffentlich befruchtenden – Konkurrenzverhältnissen. Aber dazu an anderer Stelle mehr, kümmern wir uns um den eigentlichen Inhalt: Wahoo SYSTM!
Apps, Apps, Apps
Kurz zur Einordnung – es gibt derzeit ja grob drei Arten von Trainingsapps und –software, mit denen man sich die Zeit auf dem Home-Trainer spannender oder effektiver gestalten kann:
1. echte (Real-World) Videos von Strecken, die man sich auf einen Computer oder Bildschirm streamt und nachradelt. Videos dazu gibt es in unterschiedlicher Qualität, Länge und von diversen Anbietern. Wahlweise gibt es noch einen Avatar, den man sich einblenden kann, da und dort minimale „social features“ und auch die Frage, ob Widerstand und Geschwindigkeit von der Software gesteuert werden – sich also die Anstrengung anpasst und damit der Realitätsgrad steigt (ist von Anbieter und Software abhängig).
2. Reine Trainingsplattformen blenden auf einem Bildschirm diverse Balken, Zonen und Striche ein, die ein Trainingsprogramm vorgeben, den Widerstand der Rolle/des Trainers steuern und – idealerweise in Form eines Trainingsplans über einen längeren Zeitraum – zum Formaufbau beitragen. Hier gibt es in der Regel kein zusätzliches Video oder eine andere Art der Ablenkung. Das Training und die zu erreichenden Wattzahlen stehen im Mittelpunkt.
3. Zwift ist wenn man so will eine dritte (eigene) Kategorie. Hier bewegt sich ein Avatar durch eine virtuelle Welt, die Gamification-Elemente sind hier definitiv am ausgeprägtesten, soziale Elemente und kleine Challenges sorgen für Zerstreuung und Abwechslung. Aufgrund der großen User-Zahlen und der guten finanziellen Ausstattung musste sich der Mitbewerb bisher immer an Zwift orientieren.
SYSTM!
Worum geht’s? Systm – ja, das ist so „richtig“ geschrieben – ist eine Plattform, die, 1. Trainings und Programme für Radfahren, Laufen, Yoga, Kraft- und Mentaltraining bietet, 2. dafür eine Vielzahl von Streckenvideos, „Pro Rides“, Filmen und Trainingsvideos bietet und 3. auf Computer (auch ohne App!), Tablet und Handy läuft. Im Details schaut das dann folgendermaßen aus:
Sportarten
Im Kern steht das Radfahren, auch wenn das Programm noch Laufen und Schwimmen als Sportarten anbietet. Für die beiden letzteren ist es aber realistischerweise vorgesehen, sich die vorgeschlagenen Trainings und Intervalle auf eine Uhr zu laden und dann außerhalb der App abzuspulen. Eine „immersive experience“, wie das oft so schön heraufbeschwört wird – also ein Hineingezogen-werden in ein realistisches und mitreißendes Trainingserlebnis – ist hier nicht wirklich zu erwarten (und stößt bei Themen wie Schwimmen naturgemäß auch irgendwie an Grenzen der Umsetzung). Beim Radfahren schaut das allerdings anders aus – hier ist es tatsächlich ein großer und sehr bunter Strauß an Möglichkeiten, die sich hier auftun und es sind viele, viele Stunden an Training und auch Spaß garantiert.
Wichtig ist in meinen Augen hingegen der Hinweis auf Yoga und Krafttraining! Traditionell ist das eines der größten Mankos von Radsportler*innen. Von 100 Radfahrer*innen wissen vermutlich rund 50, dass Rumpfstabilität und Core-Kräftigung fürs Radeln förderlich sind, 20 der 100 machen vermutlich hie und da etwas Training und 5 der 100 haben das regelmäßig in ihre Abläufe integriert. Ich gehöre hingegen zu dem hartnäckigen einen Prozent, die a) wissen, dass Coretraining sehr wichtig wäre, b) mit fast-Bandscheibenvorfällen auch schon mehrfach die (potentielle) Rechnung fürs Nichtstun präsentiert bekommen haben und es c) trotzdem nicht auf die Reihe bringen, die wenigen notwendigen Minuten aufzubringen, sich ein paar Mal zu strecken und zu kräftigen… Umso dankbarer bin ich, wenn es ein gutes und angeleitetes Training gibt, das ich auf „meiner“ Trainingsplattform gleich in der Übersicht vor den Latz geknallt bekomme und so immer wieder dezent drauf hingewiesen werden, gefälligst etwas zu machen! Dabei lassen sich Intensität, Dauer und Fokus der Trainings frei wählen, knapp 60 Einheiten stehen dafür zur Auswahl. Die Hemmschwelle ist dabei sehr niedrig: es sind keine Tools oder Geräte notwendig, oft braucht es nicht einmal eine Fitnessmatte. Und wenn am Bildschirm jemand die Übungen vormacht ist auch die Versagensangst geringer, den Arm in die falsche Richtung zu strecken oder sich irgendwo falsch zu belasten. Die einzige Challenge stellt sich, wenn man die ersten Male die Core-Trainings macht: die Abfolge der Übungen ist recht schnell und zackig, hier muss man sich erst zurechtfinden und sich „eingrooven“.
Und eine Nummer ruhiger (aber nicht zwingend weniger anstrengend) sind die Yoga-Einheiten. Auch hier gibt es die Differenzierung und Wahlmöglichkeit nach Dauer, Intensität und Yogi-Level, wiederum sind es rund 60 Videos zwischen 3 Minuten und 1 Stunde.
Von mir beim Yoga zeige ich lieber kein Foto her… da muss ein Screenshot aus der App herhalten! :)
Arten von Rad-Trainings („Channels“)
Kommen wir zum Kern der Sache und zwar den Möglichkeiten, ein Radtraining abzuspulen – und da gibt es einige, in ganzen neun unterschiedlichen Kategorien:
Sufferfest
Die Trainingsvideos von Sufferfest sind so etwas wie die Basis von Wahoo Systm. Dabei handelt es sich um Videos, die anspruchsvolle Trainingseinheiten mit Spaß und Unterhaltung verbinden. Die Zonen, Watt und Stufen des Trainings werden eingeblendet, wie man das auch von anderen Plattformen kennt, oben drauf gibt es allerdings Videos, die zumeist Ausschnitte von Profirennen wiedergeben und mit den Trainingsinhalten synchronisiert sind. Wobei „synchronisiert“ hier nicht auf Steigung oder Wattzahlen abzielt sondern eher auf eine „situative Synchronisierung“ – so wird zum Beispiel bei einem kurzen und harten Intervall eine Attacke aus der Spitzengruppe eingeblendet, oder aber man findet sich in einer Fluchtgruppe und soll mit einem hohen Tempo-Effort dem Peloton davonfahren. Genauso rollt man in Intervallpausen dann aber auch locker mit dem Feld mit, scherzt mit den anderen Fahrer*innen oder befindet sich in einer landschaftlich schönen Abfahrt. So vergeht zum einen die Zeit recht schnell, zum anderen hat der Geist auch etwas, worauf er sich einstellen kann oder aber bestimmte Situationen am Rad, die man mit dem Trainingsblock assoziieren kann. Alles in allem funktioniert das sehr gut und oft genug endet ein (hartes) Training mit dem Sieg eines Rennens oder einer Etappe im Video – die Belohnung kommt also instantly.
Fahr, du Sau!
Trainings und Intervalle machen selten Spaß – das ist ja auch nicht ihre ureigenste Aufgabe… Allerdings scheinen die Sufferfest-Videos schon eher auf der anspruchsvollen Seite zu sein, nicht umsonst steckt das Leiden schon im Titel drinnen. In diesem Licht sind viele Einheiten dann eher ein Durchbeißen und Kämpfen und auch die – teils schon fast derben – Motivationssprüche tragen ihren Teil dazu bei, dass es hier um „Glory through Suffering“ geht!
GCN
Das Global Cycling Network ist den meisten wohl bekannt, entweder von Beginn an durch den gleichnamigen Youtube-Kanal oder aber durch andere Aktivitäten, ist GCN doch mittlerweile an vielen Ecken aktiv. Bei den Trainings auf Wahoo Systm wird man von den bekannten GCN-Gesichtern nach dem Muster eines Gruppentrainings durch Einheiten geführt. Viel mehr gibt’s dazu nicht sagen. Ich persönlich bin kein immens großer Fan von GCN, daher ist für mich der Reiz dieser Videos überschaubar, wer jedoch eine entsprechende Affinität besitzt, für die oder den ist das aber vielleicht genau das richtige!
Inspiration
Hier sind tendenziell eher lockere oder ruhigere Einheiten gesammelt, während derer man mit spannenden, aufschlussreichen oder inspirierenden Videos aus der Welt des Radfahrens bei Laune gehalten wird. Es hat etwas von Youtube-Schauen mit Trainingsreizen und das Programm ist vielfältig: ganze Filme wie das großartige „A Sunday in Hell“, Dokus der Rennteams, inspirierende Radreisen mit Lael Wilcox, Making an Hour-Record mit Rohan Dennis, die „Outskirts“-Filmreihe, „Thereabouts“ oder aber Dokus und Blicke hinter die Kulissen einer Welt von Tommeke, Wout van Aert und Mark Cavendish.
Wahoo Fitness
Ehrlicherweise weiß ich nicht genau, was man mit den Trainings dieser Kategorie machen soll bzw. wo sie hingehören. Es handelt sich um jeweils vier Sets von Trainings (jeweils Endurance und Race Pace), die allesamt sehr lang sind und ohne Video daherkommen und damit wohl auch für die Ausübung draußen gedacht sind.
NoVid
Wobei genau für die Ausübung draußen gibt es dann eben auch eine eigene Kategorie von Einheiten ohne Video-Unterstützung oder –Ablenkung. Man kann diese natürlich auch am Hometrainer abspulen, bekommt dabei dann aber eben nur die Balken des Trainings und der Intervalle angezeigt. Die Möglichkeit, diese Videos auf den Radcomputer zu transferieren, legt aber nahe, dass man diese „mit raus nehmen“ sollte. Inhaltlich ist da alles dabei, was man sich nur denken kann – Intensitäten, Zonen, Längen, alles.
A Week with
Nummer eins der – in meinen Augen – spannendsten Channels machen die Trainings, in denen man eine Woche lang (5-6 Tage) einen Pro bzw. bekannten Radler „begleiten“ kann und gemeinsam mehrere Trainingsblöcke durchläuft. Zur Auswahl stehen hier derzeit Phil Gaimon, Neal Henderson und Ian Boswell. Dabei ergeben sich spannende Einblicke und das Konzept macht Freude und Laune.
ProRides
Weniger Freude und Laune als vielmehr viel Laktat und großen Respekt vor den Leistungen von Profis erzeugen die Pro Rides. Dabei kann man aus unterschiedlichen Rennen und Etappen wählen und einen Pro im Einsatz begleiten. Es werden dafür die echten Leistungsdaten dieses Fahrers bzw. dieser Fahrerin von genau dieser Stage herangezogen und auf die Leistungsstufe des Wahoo Systm-Nutzers bzw. Nutzerin runtergerechnet. Wenn also Tosh van der Sande 400 Watt tritt, sind es auf dem Home Trainer übersetzt 300, der Grad der Anstrengung sollte aber ähnlich sein. Und wie das bei einem echten Rennen ist, gibt es hier keine langen und gleichmäßigen Intervalle sondern ein stakkato-artiges Auf und Ab der Leistungskurve, je nachdem ob man gerade im Windschatten oder an der Spitze fährt, ob es bergauf geht oder bergab, ob man im Peloton mitrollt oder versucht, zur Spitzengruppe aufzuschließen. Wie schon erwähnt, erzeugt das (zumindest bei mir) einen sehr hohen Realitätseindruck, es ist als wäre man tatsächlich mitten im Rennen dabei. Zum anderen ist der Einblick in die Welt und die Leistungsfähigkeit von Profis etwas ganz besonderes und mein Respekt für die Leistungen steigt angesichts solcher Programme massiv an. Die Pro Rides sind aus meiner Sicht jedenfalls eines der großen Alleinstellungsmerkmale von Systm und sollen laut Hersteller noch weiter ausgebaut werden.
On Location
Michael Cotty ist vielen von den Youtube-Videos des Col Collective bekannt – schon dort hat er in einer schönen Mischung Radsport, Tourismus, Geografie und Geschichte vermischt und als Reiseberichte von den schönsten Radsport-Bergen der Welt ins Netz gestellt. Ähnlich läuft das nun bei den „On Location“-Videos in Systm ab: Reiseführer Cotty leitet dabei Trainingseinheiten durch wunderbare Radsportregionen wie die Pyrenäen, die Provence oder die Mittelmeerküste. Dabei läuft ein strukturiertes Training ab, das zur Topographie und zur Strecke passt, gleichzeitig erhält man in kurzen Einspielern, Informationen über Land und Leute, lokale Bräuche, Architektur und Kulinarik. Das kommt meiner persönlichen Art des Radfahrens sehr nahe – so ein Format nun auch für meine Indoor-Trainings zur Verfügung zu haben, macht mich sehr zufrieden.
Fitness Test
Zum Abschluss hier noch jene Kategorie, die eigentlich am Beginn und vor allen anderen Trainingseinheiten stehen soll – Leistungentests! Werden hier doch die Basiswerte ermittelt und festgelegt, nach denen sich die Intensitäten aller darauffolgenden Aktivitäten orientieren. Neben dem bekannten Rampentest wird man hier allerdings eines vergeblich suchen: den klassischen FTP-Test!
4DP statt FTP
Wahoo bzw. deren Head Coach Neal Henderson setzen statt FTP auf „4DP“ – Four-Dimensional Power. Die vier Superpowers sind Neuromuscular (Sprints), Anaerobic Capacity (Attacken), Maximal Aerobic Power (Klettern) und FTP (Ausdauer). Diese vier Aspekte sind beim 4DP-Fitness Test alle gleich gewichtet und werden dementsprechend auch gleichwertig ermittelt, anstelle eines FTP-Tests, der sich „nur“ auf die 20 Minuten FTP konzentriert. Der 4DP-Test ist auf den ersten Blick dann auch angsteinflößend, soll man doch neben dem bekannten 20 Minuten FTP-Test auch noch zusätzlich 5 Minuten Anaerobic, Sprints und Over-Threshold fahren. Der Test macht dann auch nicht wirklich Spaß – so ist es aber grundsätzlich bei allen diesen Tests… Am Ende hat man jedoch ein recht komplett wirkendes Profil seiner Stärken und Schwächen.
Mein persönliches Profil gibt beispielsweise aus, dass ich ein „Sprinter“ bin (wo ich doch viel lieber ein Puncheur sein wollte…). Viel spannender ist allerdings ein Blick in die detaillierteren Analysen, die Systm aus dem 4DP-Test zieht. So wird mir attestiert, dass es nicht wirklich möglich ist, meinen FTP-Wert zu erhöhen, solange mein „MAP“-Wert nicht zuerst gesteigert wurde. Ich sollte mein Trainings also zuerst auf meine Maximum Aerobic Power konzentrieren, um dann in Folge erst meinen FTP-Wert weiter steigern zu können – ein spannender Aspekt, den ich zuvor noch nicht so betrachtet habe.
Knowledge Base
Wer grundsätzlich mehr Interesse an solchen und anderen trainingswissenschaftlichen Hintergründen hat und auch inhaltlich verstehen möchte, warum er oder sie jetzt gerade so oder so viel Watt treten soll, der/die findet auf der Plattform auch recht ausführliche Artikel, Hintergrundinformationen und Blogbeiträge zum Thema Training.
Trainingsplan
Allerdings ist kein Einzeltraining effektiv, wenn es aus dem Kontext gerissen wird. Grundintention der Plattform bzw. eines gewünschten Leistungszuwachses ist daher, einen Trainingsplan zu starten. Im Ablauf schaut das so aus, dass man den oben erwähnten 4DP-Leistungstest absolviert, sein Profil erhält, gewünschte Sportarten, Zeitraum und Intensität wählt, optional Yoga, Kraft- und Mentaltraining oben drauf packt und fertig ist der Trainingsplan. Dabei sind dem Design des Trainingsplans wenig Grenzen gesetzt, man sollte jedoch halbwegs wissen, wo die eigenen Möglichkeiten liegen – und damit meine ich weniger die individuelle Leistungsfähigkeit als die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, den Trainingsplan auch durchzuziehen. Kann man den Trainingsplan zeitlich bewältigen? Ist die Anzahl der Einheiten richtig gewählt? Ist die Intensität eh nicht zu hoch? Solche Fragen sollte man sich selbst (kritisch) stellen oder aber mit einem Trainer oder eine Trainerin besprechen, bevor man sich in das mehrwöchige Korsett eines Trainingsplans begibt. Denn es muss auch klar sein, dass die Ergebnisse eventuell nicht die erwünschten sind, wenn man nur halbherzig jede zweite oder dritte Einheit bestreitet. Ansonsten gefällt der Modus Trainingsplan sehr gut, vor allem der Fokus auf die spezifischen Bereiche (gemäß 4DP) vermittelt den Eindruck, dass man tatsächlich bei jeder Einheit sieht, wofür das ganze gerade gut ist.
Manko – wie bei jedem (online) Trainingsplan – ist jedoch, dass man den Trainingsplan nur bedingt „mit nach draußen“ nehmen kann. Zwar lassen sich etliche Videos auch am Wahoo speichern und (als „NoVid“ sowieso) auch im Freien absolvieren. Umgekehrt fehlt aber die Möglichkeit, Einheiten von Draußen in den Trainingsplan zu integrieren oder in Systm abzubilden. Was im Winter eher weniger ein Problem ist (weil man vielleicht ohnehin lieber drinnen bleibt), ist in der Übergangszeit und im Sommer mitunter schwierig.
Der in Systm integrierte Kalender gibt eine guten Überblick über die absolvierten Trainingseinheiten, bildet aber eben „nur“ Systm-eigene Einheiten ab. Der Umweg über eine andere Plattform (z.B. Strava) gibt dann zwar ein vollständiges Bild der Trainings und Ausfahrten wieder, hat aber eben keinen Einfluss auf die Trainingsplanung.
Mein persönliches Fazit zu den Trainingsplänen ist ein gemischtes. Ich war noch nie konsequent und ehrgeizig genug, meinen Rad-Alltag einem Plan zu unterwerfen. Als Berufstätiger und Vater fehlt mir außerdem auch oft die Zeit (oder die Energie), um die Einheiten des Tages dann auch entsprechend unterzubringen. Allerdings ist es toll, im Hintergrund so etwas wie eine grobe Guideline zu haben, worauf man seine Trainingseinheiten fokussieren sollte. Und das nutze ich gerne und so oft ich kann!
Gamification
Heutzutage geht nichts mehr ohne Gamification und viele – ich auf jeden Fall! – sind da auch empfänglich dafür. (Und wenn es dabei hilft, besser auf dem Rad zu werden, dann gerne…). Es gibt auf der Plattform zahlreiche Goodies, Achievements, Badges und Belohnungen, wenn auch nicht so ausgeprägt wie bei anderen Plattformen. Die soziale Gamification entfällt auf Systm, da ist man eher als Einzelkämpfer dabei. Gamification im weiteren Sinne sind dann auch die Videos und deren Aufbau, die auf spielerische Art und Weise versuchen, den User und die Userin vom harten Trainings abzulenken – sei es durch Abwechslung, Ablenkung oder Zuspruch! Die Möglichkeiten der Plattform sind groß und zahlreich genug, dass man länger dran Freude finden kann und bei der Sache bleibt.
Technisches
Systm läuft auf Windows, macOS, iOS und Android, der benötigte Speicherplatz und die restlichen Systemanforderungen sind sehr überschaubar. Zum Abspielen der Videos ist eine aktive Internetverbindung erforderlich, ist diese zu langsam werden die Videos runterskaliert oder im schlimmsten Fall „pausiert“ – das Training läuft dabei im Hintergrund weiter. Es gibt allerdings die Möglichkeit, ausgewählte Videos vorab herunterzuladen und lokal abzuspeichern, damit lässt sich die erforderliche Internetverbindung elegant umgehen. Videos müssen allerdings einzeln zum Download ausgewählt werden (bei Trainingsplänen wäre es beispielsweise toll, wenn man alle Einheiten einer Woche auf einmal runterladen könnte), außerdem steigt damit natürlich der lokale Speicherplatzbedarf (rund 1GB pro Video-Stunde) – das könnte für all jene unter uns problematisch werden, die auf dem iPhone schon 30.000 Fotos ihrer Kinder oder Katzen gespeichert haben…
Idealerweise nützt man Systm mit einem Smart Trainer, dessen Widerstand von der Software gesteuert wird. Die Geschwindigkeiten sind virtuell und mehr oder weniger willkürlich, geht es doch in erster Linie um Wattvorgaben und nicht darum, wie schnell man im Programm unterwegs ist. Ähnlich vernachlässigbar sind etwaige Climb-Funktionen wie beim Wahoo Kickr Bike.
Fazit
Ich bin ein ganz schlechter Trainierer und die Vorstellung von strukturiertem Training lässt mich erschaudern. Umso dankbarer bin ich für jeden (spielerischen) Input, der mich dazu treibt, doch mehr zu machen, als nur spazieren zu fahren oder lockere Einheiten zu absolvieren. Systm drängt mich dazu, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen, schreit mich an, treibt mich an, hilft mir aber gleichzeitig auch, wenn es gerade hart ist. Die Videos von Sufferfest vermitteln etwas von einem vermeintlich archaischen (und in meinen Augen an sich veralteten) Heldentum, dem klassischen „Glory through Suffering“ – das mag einem ge- oder missfallen, ehrlicherweise ist es aber ein gutes Gefühl, wenn man sich erfolgreich durch eine harte Einheit gekämpft hat und den belohnenden Finish-Screen präsentiert bekommt. Mehr mein Metier sind die „On Location“-Videos mit Michael Cotty, in denen ich durch Geografie und Geschichte davon abgelenkt werde, dass mir gerade der Schweiß von der Stirn tropft. Definitiv was Neues und Spannendes sind die ProRides, da fällt mir auf die Schnelle keine andere Plattform oder Software ein, die etwas vergleichbares bieten kann – spannend und fordernd und ein toller Einblick in das, was ein Profi leistet.
Bei monatlicher Bezahlung sind für Wahoo Systm 16,49 Euro zu berappen, im Jahresabo wird es etwas günstiger. Der Preis liegt damit irgendwo zwischen Zwift und Trainerroad. Wer von Zwift kommt und etwas mehr Struktur und neue Inputs abseits der puren Gamification und den „social features“ sucht, für den ist Wahoo Systm eine spannende Option. Wer nur pures Training haben möchte – ohne Ablenkung und ohne weitere Inputs, der ist eher bei Trainerroad zuhause.
Nachdem für mich dieses Jahr einige größere Projekte auf dem Plan stehen und ich meine „Junk Miles“ zumindest eine Spur reduzieren möchte (auch wenn sie am meisten Spaß machen), kommen mir die strukturierten Trainingsoptionen von Systm genau recht. Ich persönlich werde daher auch den beginnenden Sommer über die Optionen von Systm nutzen, wenn sich ein Fenster für ein kurzes Training ergibt. Fast noch etwas wichtiger sind mir aber im Moment die Angebote des Kraft- und Rumpftrainings – hier habe ich seit jeher meine Defizite und auch hier bin ich über eine etwas spielerische Option dankbar, die mich zumindest ab und zu auf die Trainingsmatte bekommt!
Für 14 Tage kann man Systm übrigens gratis testen, macht euch gerne selbst ein Bild! Viel Spaß und „Ride On“ (oops nein, das sagt man ja auf der anderen Plattform…) ;)
Der ultimative Guide zum Thema Wintergewand
Ich weiß schon, was jetzt kommt… „Was will er mit einem Winter-Guide, jetzt wo der Frühling an die Tür klopft“? Naja, ganz einfach: Wer wie ich die Dinge auch wirklich testen, ausführen und ausprobieren möchte, braucht den ganzen Winter, um das zu tun. Und nachdem man nach zwei Kilometern noch keinen vollständigen Eindruck von Funktionen und Möglichkeiten haben kann, führt man die Dinge am besten gleich ein paar Mal aus. Und das ist insofern wenig dramatisch, denn der nächste kalte Tag kommt sicher noch und der nächste Winter sowieso. Und die meisten (alle?) der hier besprochenen Dinge, sind auch über eine Saison hinweg gültig - auch wenn sich da und dort vielleicht die Farbe eines Kleidungsstücks verändern wird.
Sich im Winter fürs Radeln anzuziehen ist jedenfalls eine eigene Wissenschaft. Bei mir hat es Jahre gedauert, um halbwegs geeignete Outfits für die unterschiedlichen Anforderungen des Winters zu entwickeln. Als eher „Erfrorener“ habe ich lieber eine Schicht mehr an als zu wenig, möchte gleichzeitig aber nicht schweißgebadet bei Minusgraden durch die Gegend fahren, das Zwiebelprinzip trägt mir oft zu sehr auf und ich hab ein Faible für gute technische Lösungen und moderne Materialen (oder auch die moderne Interpretation traditioneller Materialien). Hier ist schon ein ganz wesentlicher Punkt erkennbar: Sich fürs Radeln im Winter anzuziehen ist eine sehr individuelle Angelegenheit und daher wohl kaum pauschal und generell zu beantworten. Jede*r hat eigene Bedürfnisse, einen eigenen Fahrstil, individuelle Ziele. Aber genau deshalb soll es hier um „Möglichkeiten“ und „Varianten“ gehen und nicht um diese eine „richtige“ Version…
Bevor es aber an - wenn man so will - "Musteroutfits" geht, möchte ich ein paar meiner Erfahrungen teilen, die sich eher um Kleinigkeiten und das "Rundherum" drehen. Denn oft sind es nicht die großen Dinge (Oberteile oder Hosen), die über Komfort, ausreichend Wärme und Spaß am Radfahren entscheiden, sondern vermeintlich unwesentliche Kleinigkeiten.
1. Baselayer
Ist Wintergewand insgesamt schon eine Wissenschaft, sind es Baselayer als solches noch einmal! Es gibt unterschiedliche Längen, Dicken, Materialien und Einsatzzwecke. Ich persönlich bin kein großer Fan eines allzu exzessiv ausgelebten Zwiebelprinzips, das wird mir dann irgendwie zu viel am Körper. Ich versuche daher, für jede Ausfahrt den am besten geeigneten Baselayer zu verwenden. Zwischen 5 und 10 Grad vertraue ich auf einen Merino-Baselayer, der verbindet in der Regel gutes Klima mit ausreichendem Wärmeschutz. Darunter (also bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt) ist mir der Merino-Baselayer insofern zu riskant, als er sich tendenziell irgendwann mit Schweiß vollsaugt und dann nicht mehr wärmt - in diesem Fall greife ich daher lieber auf Mischfasern (mit Merino) zurück und nicht auf reine Woll-Shirts.
2. Schuhe/Winterschuhe
Anziehen für den Winter-Ride ist eine schweißtreibende Angelegenheit - spätestens dann, wenn man sich in voller Montur kurz vorm Verlassen der Wohnung noch Überschuhe anziehen möchte. Um das zu verhindern und gleichzeitig auch einen idealen Wetterschutz zu haben, fahre ich schon seit mehreren Jahren nur noch mit dezidierten Winterschuhen. Diese sind schnell angezogen, bieten Schutz vor Kälte und Nässe und tragen meistens auch nicht so dick auf wie Schuhe plus Überschuhe. Bei letzterem ist es mir bei einigen Rädern schon passiert, dass ich mit der Innenseite des rechten (Über)Schuhs an der Kurbel streife. Auch bei Winterschuhen gibt es natürlich Qualitätsunterschiede - hier ist darauf zu achten, dass die Schuhe auch eine entsprechende Innensohle haben, die nach unten hin abdichtet oder isoliert. Von Übersocken halte ich hingegen wenig - einerseits verstehe ich den Nutzen nicht ganz, andererseits war das eine Paar, das ich mal in Verwendung hatte nach einer Ausfahrt reif für die Mülltonne.
3. Handschuhe
Die Velits-Brüder von Isadore haben einmal erwähnt, dass ein Handschuh das am schwierigsten zu fertigende Bekleidungsstück beim Radeln ist. Form, Größe, Materialien, Nähte, Touchscreen-Fingerkappen, und und und... Ich persönlich habe auch nach vielen Jahren und Wintern auf dem Rad noch keine definitive Lösung für meine Finger gefunden und kalte Finger bedeuten zwangsläufig irgendwann auch, dass einem am ganzen Körper kalt wird. Ich verwende daher wenns hart auf hart kommt tatsächlich noch meine Radhandschuhe, die ich vor 20(!) Jahren zum Mountainbiken angeschafft habe.
4. Ärmlinge/Beinlinge
Auch Ärmlinge und Beinlinge geben immer wieder Stoff für Diskussionen. Ich bin kein Fan davon und bevorzuge eigentlich immer lange Ärmel und Beine, wenn es die Witterung erfordert. Einzig bei Ausfahrten im Frühling oder Herbst nehme ich ab und zu Ärmlinge mit, um etwas flexibler zu sein. Ansonsten fällt mir zum Thema nur eine Aussage von Tom Boonen ein, der einmal gemeint hat, man erkenne am Start der Frühjahrsklassiker an den Beinlingen, ob ein Fahrer in die Flucht geht oder nicht - hat er sie über die Hose gezogen, wird er sie schnell und bald ausziehen, um in die Flucht zu gehen. Alle, die sie unter dem Hosenbund haben, können es gemütlicher angehen lassen. Weiß nicht ob das so stimmt, klingt aber irgendwie plausibel - am besten wir schauen uns das bei den kommenden Eintagesrennen an.
5. Buffs
Gegen Buffs habe ich mich lange gewehrt, weil ich nicht gerne etwas um den Hals gewickelt habe. Mittlerweile habe ich die Vorzüge erkannt, schätze Buffs sehr und führe zumindest immer einen mit - egal ob in Trikot-, Lenker- oder Rahmentasche. Das kleine Stück Stoff ist dabei sehr vielseitig einsetzbar und man darf nie ein trockenes und wärmendes Stück Stoff am Körper unterschätzen.
6. Hauben
Merino, über die Ohren, nicht zu dick - das sind die wesentlichen Punkte, die es bei Hauben zu beachten gilt. Gerade unter dem Helm sollte nichts drücken oder quetschen, daher am Besten gemeinsam mit dem Helm probieren. Merino habe ich an dieser Stelle lieber als Mischfasern, weil sie sich am Kopf und an den Ohren geschmeidiger anfühlen und die Schweißproblematik am Kopf (bei mir zumindest) nicht so groß ist. Und die Brillenbügel unter dem Haubensaum öffnen den Raum zu den Ohren hin und machen Platz für kalten Fahrtwind - ich trage daher die Brillenbügel immer über der Haube.
7. Helme
Wir bleiben noch kurz am Kopf mit einem vermeintlichen No-Brainer: Wer die Auswahl zwischen unterschiedlichen Helmen hat, kann im Winter auf einen Aero-Helm zurückgreifen. Die haben in der Regel weniger Luftschlitze und Öffnungen und halten daher eher warm als das gut belüftete Sommermodell. Und ein paar Aero-Gains können auch im Winter nicht schaden ;)
8. Socken
Auch hier setze ich persönlich gerne auf Merino - die Wolle hält warm, trocknet gegebenenfalls schnell und fühlt sich gut und komfortabel an. Wichtiger als das Material ist bei den Socken fast mehr die Frage, ob diese über oder unter der Hose getragen werden. Styletechnisch bin ich in der Über-der-Hose-Fraktion zuhause, nur wenn es richtig kalt ist kommen sie unter das Hosenbein, denn dort scheint mir die Isolation und die Wirkung der warmen Socken noch eine Spur besser zu sein.
9. Farben
Farben sind mir ein wichtiges Thema! Zum einen finde ich schwarz langweilig, zum anderen finde ich, dass Farbakzente das Leben schöner machen. Ganz abgesehen davon, dass gerade im Winter und bei schlechterer Sicht die Sichtbarkeit von Farben weitaus höher ist, als das klassische Anthrazit und Schwarz. Ich freue mich auch, dass mehr und mehr Marken nicht nur bunte oder farbenfrohe Trikots anbieten, sondern zunehmend auch Hosen (siehe unten!). (PS: Weiße Hosen gehen nach wie vor nicht - ich hoffe, das wird nie ein Trend..)
10. Nachhaltigkeit und Materialien
Auf den ersten Blick mag das nicht das wichtigste Kaufargument sein, aber der Stellenwert von Nachhaltigkeit und der Wertigkeit und Herkunft von Materialien steigt immer mehr, ebenso wie Fertigungsorte und -bedingungen. Das Bewusstsein der Konsument*innen und Marken steigt hier glücklicherweise von Jahr zu Jahr, auf den Homepages der Hersteller findet man in der Regel ausführliche Informationen zu Zertifikaten, Siegeln, und dergleichen, wobei hier - wie immer - auf eine kritische Lesart zu achten ist. Das eine oder andere "Gütesiegel" kann sich auch schon mal als Mogelpackung erweisen.
11. Streckenwahl und Intensität
Zum Abschluss der kleinen Erfahrungen noch etwas, was erst auf den zweiten Blick mit dem Thema zu tun hat. Denn auch die Streckenwahl, das Tempo, die Intensität und vielleicht auch die Wahl des Rads (Rennrad, Gravel, MTB) wirken sich auf das Wintererlebnis im Sattel aus. Bei Minusgraden wird man sich am Anstieg nass schwitzen und in der anschließenden Abfahrt mit großer Wahrscheinlichkeit erfrieren - da fährt man also lieber mit geringerer Intensität und wählt ein flaches Streckenprofil. Wind Chill und ähnliches machen vielleicht das "langsamere" Gravelbike zur besseren Wahl für den Winterride.
Doch genug der allgemeinen Rederei... Ich habe für euch fünf Serviervorschläge vorbereitet und diese einen Winter lang getestet und probiert. Außerdem hab ich versucht, das Ganze in unterschiedliche Kategorien zu unterteilen, sodass für jeden Einsatzzweck und Geschmack etwas dabei ist.
Outfits:
RH77 - Das Performance-Paket
René Haselbacher und sein Team bringen viel Erfahrung aus dem Profiradsport mit - und vielleicht noch wichtiger: Erfahrungen von unzähligen Trainingsstunden im Sattel bei jedem möglichen Wetter.
Offiziell als Jacke tituliert, hat man bei der "Sub-Zero Winter Membran" eher den Eindruck, ein Langarmtrikot zu tragen. Dementsprechend fühlt sich das ganze recht leicht an und trägt nicht auf. Das Material ist sehr stretchy und passt sich gut dem Körper an. Mit einem langärmligen Baselayer reicht der Wetterschutz für kurze bis mittellange Ausfahrten, wer länger unterwegs sein möchte oder zusätzlichen Wetterschutz benötigt, kann ein dünnes Langarmtrikot zwischen Baselayer und Jacke anziehen. Das Material saugt sich nicht mit Schweiß voll und hält daher auch bei intensiveren Rides warm (bis zu einer Dauer von 2-2,5h). Das Design schreit nach Aufmerksamkeit und man wird von weithin wahrgenommen - auf winterlichen Straßen ein Pluspunkt. Sollten die Bedingungen doch etwas harscher werden, helfen die Wind- und Wasserbeständigkeit und der ausklappbare Spritzschutz am unteren Rücken.
Die Hose kommt in einem schönen Blau und bietet damit eine willkommene Abwechslung vom schwarzen Einheitsbrei. Der Wetterschutz ist auch hier eingebaut, allerdings nicht so ausgeprägt wie beim Trikot. Aber das Thermomaterial an der Innenseite hält für die Dauer von kurzen und mittellangen Ausfahrten angenehm warm. Sitzpolster sind ja an sich ein sehr individuelles Thema und für jede*n unterschiedlich komfortabel. Hinsichtlich Qualität und Komfort der RH77-Polster herrscht allerdings seltene Einigkeit über viele Personen hinweg - diese sind bei dieser Winterhose genauso gut wie bei den RH77-Sommerhosen.
Wer übrigens in und rund um Wien in RH77 unterwegs ist, wird Teil einer eigenen Community und wer weiß, vielleicht kreuzt man hie und da auch die Wege von René Haselbacher selbst...
Isadore - Das Sub-Zero-Paket
Auch bei Isadore werken bekanntlicherweise im Hintergrund Ex-Profis. Die beiden Brüder Martin und Peter Velits waren beide in der World Tour unterwegs und haben gegen Ende ihrer Karrieren damit begonnen, Radbekleidung herzustellen. Isadore setzt in großem Maße auf Merino als Material und legt gleichzeitig großen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität - davon kann man sich in zahlreichen Artikeln auf deren Homepage überzeugen. Neben der performance-orientierten "Echelon" Kollektion gibt es bei Isadore zwei Eskalationsstufen von Winter, die ich - als "Erfrorener" - gerne in Anspruch nehme. Das "Thermerino"-Jersey gemeinsam mit den Medio Tights bieten Schutz und Wärme knapp über Null Grad, die Merino Membrane Softshell Jacke mit der Ovada Deep Winter Tight auch bis weit unter Null. Die Materialien sind dabei so angelegt, dass sie Wärme, gute Isolation und Witterungsschutz bieten, allerdings eher für weniger intensive Einheiten. Vor allem ein (an sich positiver) hoher Merinoanteil sorgt bei Isadore oft dafür, dass bei höherer Intensität durch Schweiß Nässe und damit in der Folge Kälte entsteht.
Die Merino Membrane Softshell Jacke hat nur einen geringeren Merino-Anteil und außen komplett abweisendes Softshell-Material - damit kommt man auch über längere Zeit durch Winter und tiefste Temperaturen. Auch hier benötigt es darunter im Wesentlichen nur einen guten Baselayer oder ein dünnes Trikot, um den vollen Schutz und Komfort zu haben. Vor Überhitzung oder zur besseren Regulierung sorgen zwei Schlitze auf Brusthöhe, die mittels Reißverschluss zu öffnen sind - damit muss man nicht die komplette Jacke aufzippen, um dem Körper Frischluft zu gönnen.
Die "Osram"-Variante der Jacke ist außerdem noch mit eingelassenen Leuchtstreifen ausgestattet, die über eine interne Verkabelung und eine Stromquelle in der Rückentasche zum Leuchten gebracht werden können. Dies erhöht die Sichtbarkeit und damit Sicherheit im Winter und im Dunkeln massiv - allerdings ist die Verkabelung und das notwendige Mitführen einer kleinen Powerbank im Alltag unpraktisch. Und es ist dabei auch eine der Rückentaschen belegt und damit nicht mehr wirklich frei für das Zeug, das man eigentlich einstecken möchte. Die Jacke ist auch ohne die Leuchtelemente erhältlich, in meinen Augen ist das die bessere Wahl.
Die Ovada Deep Winter Tight ist ein großartiges Stück Winterkleidung für jene, die diese Extraportion Witterungsschutz und Wärme haben möchten. Das Material ist dick und vermittelt schon in den Händen gehalten ein Gefühl von Sicherheit und Komfort. Angezogen fühlt sich die Hose nicht so dick und klobig an wie befürchtet und schmiegt sich gut an den Körper an. Das Thermomaterial und die schützende Aussenschicht sind vorne weit über den Schritt hochgezogen, damit entfällt die gerötete und erfrorene Haut am unteren Bauch, mit der man so oft nach Winterrides nach Hause kommt. Auch der Rücken ist weit hochgezogen, sodass man mit dieser Hose fast auch schon einen zweiten Layer am Oberkörper trägt. Beide Thermohosen sind übrigens eher auf der engeren Seite und sollten tendenziell eine Nummer größer bestellt werden.
Löffler - Das Offroad-Paket
Abseits der Straßen bietet der Winter unzählige Möglichkeiten und wie oben schon erwähnt, sind Gravel- und Mountainbike hier mehr als nur eine gute Alternative. Offroad zählen andere Faktoren als Schnittigkeit und Windschlüpfrigkeit und hier tritt Löffler auf den Plan. Die Firma aus dem oberösterreichischen Ried im Innkreis legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität und hat seine Wurzeln im Wintersport. Dementsprechend überrascht es nicht, dass einzelne Technologien auch ihren Weg in die Radkollektionen gefunden haben und hervorragend für winterliche Ausflüge geeignet sind.
Die Bike Jacket PL Active ist mit Primaloft gefüllt und bietet eine tolle Isolierung und damit einen warmen Oberkörper egal wie tief das Thermometer absackt. Die Außenhülle ist dabei gleichzeitig wind- und wasserabweisend. Die Passform ist - wie bei Löffler üblich - weniger sportlich als bei den dezidierten Rennrad-Marken, man fühlt sich weniger in einem Langarm-Trikot als mehr in einer Winterjacke. Das mag psychologisch einer flotten Rennradrunde im Weg stehen, für einen winterlichen Offroad-Ausflug ist das allerdings genau das richtige. Gute Abschlüsse an Ärmeln und Kragen sorgen dafür, dass die Jacke an allen Enden dicht ist und warm hält. Am Rücken gibt es nur eine große Tasche, in der man auch die Jacke selbst verstauen kann - ich persönlich habe lieber drei vollständige Taschen am Rücken, die ich mit meinem Kleinkram befüllen kann. Als Ersatz bietet Löffler dafür eine Tasche mit Zip an der Vorderseite, in der man Kamera und/oder Wertsachen verstauen kann.
Wetterschutz steht an erster Stelle bei den Bike Overpants GTX Active, wobei es sich hierbei eigentlich weder um eine eigenständige Radhose noch um eine dezidierte Winterhose handelt. Die Overpants GTX sind als Überhose konzipiert, das heißt man muss darunter schon eine Bib-Short anhaben. Neben dem Rad schaut man eher ungelenk und “patschert” aus - der Bund der Hose ist niedrig, die Knie sind massiv ausgebeult. Sobald man aber im Sattel sitzt, ist alles an seinem Platz und dank GoreTex trotzt man auch dem schlimmsten Regen, Matsch und Schnee. Die Atmungsaktivität leidet da naturgemäß etwas darunter, aber normalerweise ist man in solchen Situationen nicht allzu intensiv unterwegs, damit wird dem drohenden Bad im eigenen Schweiß wiederum etwas der Schrecken genommen. Die Hosen wären grundsätzlich auch als sinnvolles Equipment für einen Bikepacking-Urlaub in Betracht zu ziehen, der Einsatzbereich ist hier nicht ausschließlich im Winter zu suchen.
Sportful - Das Frühjahrsklassiker-Paket
Sportful und Castelli kommen aus dem gleichen Haus und beide haben ein besonderes Pferd im Stall - bei Castelli heißt es Gabba, bei Sportful "Fiandre". Was bei Sportful liebevoll mit Flandern umschrieben ist, markiert im Wesentlichen die Frühjahrsklassiker mit ihrem unsicheren Wetter, dem Schmutz der Feldwege, der Brutalität des Kopfsteinpflasters und der Verwegenheit der Frauen und Männer, die sich über die berühmten Parcours und Hellingen kämpfen. Aufs Material und die Bekleidung umgelegt bietet die Fiandre-Kollektion eine Lösung für die Übergangszeit, den kalten Frühling, die frostigen Morgen, die wechselnden Wetterbedingungen, den vereinzelten Regenschauer, unerbittlichen Wind und alle anderen Rahmenbedingungen, die das Frühjahr auszeichnen. In einem Vergleich von Wintergewand kämpft man hier mit etwas stumpfen Waffen, allerdings ist es ja nicht den ganzen Winter so richtig winterlich (genauso wie es nicht den ganzen Sommer sommerlich ist). Ehrlicherweise werden die sogenannten Übergangszeiten immer länger und gerade für diese vielfältigen und schnell wechselnden Anforderungen sind diese Stücke hier gemacht.
Die Jacke (Fiandre Pro Jacket) besitzt an der Innenseite aufgerauchtes Polartec Neoshell Material - klingt technisch, ist in der Praxis aber warm und kuschelig. Nach außen hin ist die Jacke wind- und wasserfest. Der Sitz ist eher eng (auch bei Sportful sollte man vor dem Kauf genau auf die Größe achten und im Zweifel eher eine Nummer größer gehen), die Bündchen schließen perfekt ab. Der Kragen ist mit einer Extra-"Lamelle" ausgestattet und etwas hochgezogen. In der Praxis ist die Jacke warm und schützt vor dem Wetter, spielt aber ihre Stärken eher bei leichten Plusgraden (5-10 Grad) aus, darunter kann man zu anderen Jacken greifen. Die drei Taschen am Rücken sind groß und gut zugänglich, einzig die Frage, warum die beiden äußeren Taschen mit Netzmaterial ausgeführt sind (und damit Wasser und Schmutz durchlassen!) wird wohl niemals beantwortet werden.
Die Hose ähnelt - sowohl in Farbe als auch Aufbau - jener von RH77. Auch hier ist das Blau eine angenehme Abwechslung, auch hier ist der Temperaturbereich eher in den Plusgraden zwischen 5-10 Grad zu suchen, darunter wird's eher kalt auf den Schenkeln.
Trikoterie - Die Wiener Variante
Etwas außer Konkurrenz aber als tolle Alternative obenrum läuft das "Hide & Seek"-Oberteil von Trikoterie. Von Wiener Künstler*innen designte Trikots stechen hier aus der Masse heraus und bringen auch farblich etwas Abwechslung in den Alltag.
Das Hide & Seek-Jersey kommt in einem coolen Herbst/Winter-Design, die Augen reflektieren übrigens und sorgen somit für eine bessere Sichtbarkeit im Winter Das Trikot fällt klein aus und sollte im Zweifelsfall eine Nummer größer genommen werden.
Wahoo Elemnt Bolt (V2) im Test
Eines vorab, weil ich schon seit gefühlter Ewigkeit darüber nachdenke, einen Wahoo vs. Garmin Post oder Video zu machen. Da hab ich mittlerweile keine Lust mehr drauf, es macht ja keinen Sinn die beiden Lager immer wieder gegeneinander aufzuhetzen, es soll jede und jeder das fahren, was am besten zu einem passt. Ich für meinen Teil habe diese Frage vor mittlerweile mehreren Jahren entscheiden, und das hat 4 kurze Gründe:
Bedienbarkeit
Logik
Funktionsumfang
Routensynchronisation.
Bei den ersten beiden Punkten kann man einen guten Vergleich ziehen, wie es zwischen Apple und Windows wäre. Wahoo ist da für mich eher wie Apple und damit etwas logischer, einfacher zu finden und intuitiver. Beim Funktionsumfang ist das ganze etwas komplizierter, da können die Garmins nominell oft mehr als die Elemnt Computer von Wahoo. Aber da finde ich tatsächlich, dass das großteils Funktionen sind, die man (also zumindest ich) nicht unbedingt braucht. Trail Forks? Climb Pro? Connect IQ? Mähh. Ich brauche gutes Routing, gute Darstellungen, ein schnelles Anpassen auf mein jeweiliges Rad und die jeweilige Art von Aktivität. Und zu den Routen kommen wir gleich noch im Detail.
Ordnen wir den Bolt V2 erst einmal ein. Ich hatte den alten Elemnt, den Bolt 1, den (ehrlicherweise etwas überflüssigen) Mini (in erster Linie, weil der ohne Telefon keine Navigation und Routen konnte) und jetzt habe ich seit einiger Zeit schon den Roam in Verwendung. Sieht man sich die direkte Nachfolge an (also Bolt 1 zu 2) ist der neue etwas größer (höher, „blockiger“) und auch etwas schwerer, aber noch immer etwas kleiner als ein Garmin 530. Und um das gleich vorwegzunehmen: Auch der Preis ist etwas gestiegen, rund 280 muss man für den Bolt V2 auf den Tisch legen. Ein ordentlicher Haufen Geld aber dafür bekommt man ja auch einiges - und er ist damit noch geringfügig billiger als der Garmin 530.
Von außen gibt es neben dem Formfaktor ein paar offensichtliche Neuerungen. Die Knöpfe sind jetzt etwas konvex und haben einen besseren (oder überhaupt erst) einen Druckpunkt, sodass man auch mit Handschuhen besser arbeiten kann. Unter der kleinen Abdeckung verbirgt sich - AAAAAHHHH - ein USB-C Anschluss. Halleluja! Ich brauche zwar auf meinen längeren oder mehrtägigen Touren noch immer mehrere Kabel, um alle meinen Geräte zu laden, aber es wird langsam.
USB-C Anschluss an der Unterseite
Voll geladen hält der Akku laut Wahoo 15 Stunden, beim größeren Roam sind es 17. Erfahrungsgemäß - und ich bin grundsätzlich immer mit Navigation, Herzfrequenz und Powermeter unterwegs - sind es geringfügig weniger. Beim Bolt V2 würde ich am Ende des Tages mit 12-13 Stunden rechnen. Noch immer viel und absolut ausreichend auch für sehr lange Touren.
Wer Akku sparen möchte, fängt am besten bei der Hintergrundbeleuchtung an, da geht erfahrungsgemäß am meisten und am schnellsten Akkuleistung verloren - auch wenn die Geschichte mit der automatische Helligkeitsanpassung an die Umgebung sehr gut funktioniert.
In the Box
Box öffnen, Wahoo auspacken, Folie runter, einschalten. Paaren mit dem Smartphone funktioniert schnell und einfach mit der Wahoo App. Diese ist grundsätzlich notwendig, um den Wahoo einzurichten, Dinge zu verändern oder zu synchronisieren (oder zumindest die Synchronisierung beim ersten Mal zu aktivieren). Und hier zeigt sich schon, wie einfach das ganze funktioniert, z.b, das Einrichten der Datenfelder. In der App ein Datenfeld auswählen, an die gewünschte Position ziehen, und schwupp - ist es auch auf dem Wahoo sichtbar. Wie oft muss man am Garmin dafür nochmal auf irgendeinen Knopf drücken? ;)
Andere Seiten kann man sich noch zusätzlich einstellen - Anstieg, Höhenprofil, Segmente, Navigation usw. Je nachdem was man braucht und verwenden möchte. Ich persönlich bin da mit Datenseite, Höhenprofil und Karte recht minimalistisch unterwegs - ich möchte ja aber auch in erster Linie Radfahren und nicht durch Datenseiten scrollen…
Spätestens auf der Kartenseite sieht man dann auch die beiden wichtigsten Neuerungen des Wahoo Bolt V2. Erstens: Farben! Das Display kann nun überhaupt Farben bzw. verglichen mit dem Roam einige mehr. Dadurch wird die Kartenansicht schöner, man kann schneller Straßentypen und Kategorien unterscheiden und es ist auch einfach schöner anzuschauen. Die Farbe kommt auch noch anderen Funktionen zugute: In der Datenansicht kann man ein Feld farblich hinterlegen und sich so zum Beispiel die aktuellen Leistungs- oder Herzfrequenzzonen anzeigen lassen. Ebenfalls in Farbe erstrahlt eine Seitenleiste, falls man mit dem Garmin Radar unterwegs ist, der einem von hinten herannahende Autos anzeigt.
Zweite Neuerung am Bolt V2: Dynamisches Routing! Bisher konnte das nur der Roam, nun weiß auch der Bolt wie man smart von A nach B kommt. Weicht man nun also von einer vorgegebene Route ab, kann der Bolt einen wieder auf den richtigen Weg zurückführen und sinnvolle Alternativen und Abkürzungen anbieten. Außerdem kann man sich natürlich auch vom Bolt dynamisch und mit Abbiegehinweisen zu einem vorher gewählten Ziel bringen lassen. Am einfachsten geht das übrigens wieder, wenn man mit der Handy-App die Wunsch-Destination auswählt. Am Bolt direkt geht das zwar grundsätzlich auch, aber mir persönlich ist das ehrlicherweise zu fummelig.
Routen
Und wenn wir schon bei Routen sind - das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Ich bin mittlerweile fast immer mit vorgefertigter Route unterwegs und habe auch 99% der Zeit die Kartenansicht eingeblendet. Ich habe es mir beim Radeln zur Mission gemacht, neue Ecken zu entdecken und für mich noch unbekannte Highlights zu befahren. Die Routen, die ich dabei auf Komoot bastle, kann ich schnell und ohne viel Aufwand auf den Wahoo bekommen - für mich eines der Key-Features. Aber da hat eben jeder seine eigenen Präferenzen.
Auf Komoot geplante Routen (oder auch von vielen anderen Anwendungen wie Strava, RidewithGPS, usw.) kann man automatisch synchronisieren lassen - das heißt jedes Mal wenn der Wahoo mit einem (bekannten) WLAN verbunden ist, wird synchroniert. Oder man synchronisiert alle oder aber auch einzelne Routen über die dazugehörige App. Das funktioniert einfach und schnell. Sogar ein GPX aus dem Internet oder aus einem File kann man im Handumdrehen auf den Bolt bekommen - quasi Copy-Paste!
Vor allem die vielen bunten Karten brauchen auch Speicherplatz und da hat der neue Bolt eines der größte Mankos des Roam ausgeräumt, hat dieser jetzt doch 16 GB Speicherplatz. Damit muss man nicht mehr mit Kartenabschnitten jonglieren oder vor dem Urlaub überlegen, für welches Land man jetzt noch schnell die Karte hochladen muss und was man dafür runterlöschen muss damit überhaupt genug Speicherplatz frei ist… Das alles ist Vergangeheit, mit 16 GB ist das kein Thema mehr. Es ist ohnehin mehr als erstaunlich, dass das oft noch so ein Problem ist, wenn ich mir überlege, wieviel eine 128GB microSD karte kostet und wie klein diese ist… Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, denkt man…
Nicht neu am Bolt V2 sondern bei Wahoo eh schon immer auch an Bord: Struktuiertes Training und Trainingsprogramme, nach denen man seine Ausfahrten anlegen kann und Live Segmente, wenns einen mal juckt. KICKR-Steuerung für den Indoor Trainer und Nachfahren von Routen auf der Rolle, usw. usf. Und wie schon gesagt: Viele Funktionen, die man auf einem riesigen Garmin 1030 finden wird, sucht man am Bolt vergeblich. Aber da sollte man sich aus meiner Sicht vorher wirklich fragen, ob man diese auch wirklich braucht.
Unabhängig davon ist Wahoo dafür bekannt, regelmäßige Updates für alle Elemnt Computer zu bringen, die dann auch neue Funktionen auf die Geräte bringen. Und sorry - dieser Seitenhieb muss sein: die Updates funktionieren dann auch und legen nicht das komplette Gerät lahm - wie das bei der Konkurrenz oft genug der Fall war oder ist…
Ein Wort noch zu den Halterungen: Wahoo verwendet wie Garmin ein Art Quartermount, allerdings um 90 Grad gedreht und die Ecken sind minimal größer. Man kann also mit etwas Gewalt und unter Verlust eines halben Millimeters Kunststoff einen Wahoo in eine Garmin Halterung hineinpressen, die elegantere Lösung ist aber ein kleiner Adapter, den es von Wahoo zu kaufen gibt, und der die ganze Geschichte um genau diese 90 Grad dreht. Im Lieferumfang enthalten ist aber ohnehin ein Aero Mount und eine weitere kleine Halterung, die man mit Kabelbindern zb am Vorbau oder aber irgendwo anders am Lenker anbringen kann. Außerdem gibt es noch eine Standardhalterung zu kaufen, eine für TT-Lenker oder aber Drittanbieter-Ware von beispielsweise K-Edge, die ich im Einsatz habe und die einen praktischen Mount für GoPro oder meine Lupine-Lampe unten dran haben. Falls das für irgendjemanden wichtig ist: Der neue Bolt passt in den Aerohalter des alten Bolt, der alte aber nicht in den Aeromount des neuen - das ist aber auch schon die einzige Einschränkung.
Apropos Einschränkung - und damit kommen wir auch schon zum Ende: Mit Corona, Lieferzeiten und Chipmangel kann es momentan eine Challenge sein, einen neuen Bolt zu finden. Wer also einen möchte und im Geschäft liegen sieht, sollte eher schnell zugreifen.
WER sollte zugreifen: Vom Roam umsteigen? Nicht unbedingt notwendig, der hat schon Farbe und dynamisches Routing und ist auch noch etwas größer. Vom alten Bolt? Ja, wenn man bessere Navigation, schönere Farben und bessere Bedienbarkeit haben möchte. Und von Garmin umsteigen? Hm, da macht euch mal euer eigenes Bild, das ist eine eigene Geschichte ;)
Noch ein paar Fotos:
Wahoo Kickr Bike im Test
Nach vier Monaten, in denen ich das Wahoo Kickr Bike durch unterschiedliche virtuelle Welten, zahlreiche Apps und Trainingsblöcke gejagt habe, ist es Zeit für ein Review und ein Fazit!
Welcher Smart-Trainer passt zu mir?
Die kalte Jahreszeit lässt sich mannigfaltig nutzen und am besten ist ohnehin, wenn man die "Off-Season" für unterschiedliche Aktivitäten nützt: Laufen oder Langlaufen als Ausdaueralternativen; Skitouren gehen, wenn man in den Bergen wohnt; Cyclocross-Rennen wenn man auch im Winter eine richtig harte Challenge sucht; Mountainbiken, wenn man seine Fahrtechnik-Skills etwas aufpolieren möchte; oder aber natürlich das klassische Rollentraining. Wobei so klassisch ist das nicht mehr, seit sowohl hardware- als auch softwareseitig enorm aufgerüstet wurde! Seitdem gibt es kein stundenlanges Pedalieren mehr vor einer weißen Wand - außer natürlich man möchte genau das, wie Jonas Deichmann... ;)
Cyclocross…
…oder Zwift?
Um in den Genuss von Plattformen wie Zwift und Co. kommen zu können, ist ein sogenannter "smarter" Rollentrainer notwendig. Dieser unterscheidet sich von einem "dummen" (also nicht "smarten") dadurch, dass er mit Computer, Tablet oder Telefon kommunizieren kann und sich auf diesem Wege auch steuern lässt. Mit dem Ergebnis, dass eine Steigung auf dem Radcomputer oder auf Zwift auch als solche spürbar wird, weil die Software den Widerstand des Rollentrainers erhöht. Gleiches gilt für Trainingsblöcke oder Intervalle, bei denen man "nur" noch treten muss - den richtigen Widerstand besorgen der Rollentrainer und das dazugehörige Trainingsprogramm. Auf diesem Wege lassen sich auch Einheiten auf der Rolle unterhaltsam und kurzweilig gestalten und der Schrecken des monotonen Wintertrainings verfliegt im Nu!
Bei der Anschaffung einer smarten Trainingsrolle sollte man vorab kurz seine Anforderungen definieren, denn die Modelle unterscheiden sich sowohl in Funktion als auch Preis mitunter deutlich. Es gibt natürlich mehrere Hersteller am Markt, von Wahoo hatte ich allerdings schon drei unterschiedliche Systeme und Modelle in Verwendung, deshalb werde ich diese als Bespiel heranziehen, um auf Unterschiede, Nutzen und Eignung einzugehen.
Arten von Rollentrainern
"Wheel-On Trainer" (Wahoo Kickr Snap)
So oder so ähnlich kennt man einen Rollentrainer bzw. so haben sie vor einigen Jahren auch schon ausgeschaut - ein stabiles Metallgestänge mit einem Widerstand dazwischen. Man nimmt sein eigenes Rad so wie es vor einem steht und spannt es in den Trainer ein. Man muss dazu lediglich den mitgelieferten Schnellspanner verwenden oder die geeignete Steckachse verwenden. Steckachsen sind da so ein Thema, so wie es teilweise auch noch vereinzelt zu Problemen mit Scheibenbremsen kommen kann, wenn schlicht und ergreifend nicht genug Platz ist, um die Scheiben noch unterzukriegen. Bezüglich der Scheibenbremsen sollte man vorab die Produktbeschreibung und die Kompatibilität checken. Bei Steckachsen ist es so, dass man dafür oft extra Adaptersets dazubestellen muss. Technisch ist das absolut problemlos aber es entstehen halt noch einmal zusätzliche Kosten - am Beispiel des Wahoo sind das immerhin 50 Euro und damit 10% des Preises des Trainers an sich. Hat man die Adapter aber einmal in Verwendung, ist das Rad sicher und stabil mit dem Rollentrainer verbunden. Einen Hebel noch umgeklappt und schon treibt das Hinterrad den Rollentrainer an und der Spaß kann beginnen. Der Widerstand verändert sich entweder - ohne Steuerung von außen - progressiv, oder aber man überlässt die Steuerung einem Wahoo Elmnt Radcomputer oder einer Trainingssoftware a la Zwift oder Trainerroad - Stichwort “smart”.
Vorteile einer derartigen Bauform sind der vergleichsweise günstige Einstiegspreis sowie die Flexibilität, so gut wie jedes Rad einspannen zu können. Wenn man zum Beispiel auf unterschiedlichen Rädern trainieren möchte - sagen wir Rennrad und Zeitfahrrad, so wie ich das im Frühjahr gemacht habe - dann geht dieser Wechsel schnell von der Hand und es sind keine Umbauarbeiten oder dergleichen notwendig. Ebenfalls ein Faktor sind unterschiedliche Antriebssysteme: bei SRAM-12fach auf meinem Zeitfahrer und Shimano 11fach auf meinem Rennrad wäre ein Wechsel immer mit einem gewissen Aufwand verbunden gewesen - mit dem Kickr Snap bzw. einem anderen Wheel-On-Trainer, kein Problem.
optionale Steckachse für den Wahoo Kickr Snap
Aufgrund der indirekten Kraftübertragung über den Hinterreifen hat man geringe Einbußen bei der Unmittelbarkeit des Fahrens - ein paar Watt werden so im System verloren gehen und auch Tempowechsel oder die von der Software gesteuerten Widerstandswechsel werden nicht so direkt und unmittelbar spürbar.
Während viele Reifenhersteller dezidierte Indoor-Reifen anbieten, kann ich dabei keine besonderen Vor- oder Nachteile feststellen. Wichtig ist da eher, dass das Rad mit all seinen Bestandteilen sauber ist, denn der Dreck vom Rad wird sich sukzessive in der Wohnung verteilen, wenn sich das Hinterrad dreht. Kann sein, dass es hier einzelne Reifen-Modelle gibt, bei denen man eventuell Abrieb merkt oder dieser sich in der Wohnung verteilt. Bei meinen Reifen (Vittoria, Pirelli und Continental) konnte ich das allerdings nicht bemerken.
Durch die unterschiedlichen (und zahlreicheren) bewegten Teile ist auch die Geräuschentwicklung bei dieser Bauform von Trainern etwas größer. Das sollte man auf jeden Fall bedenken, wenn man kein Haus sein eigen nennt oder empfindliche Nachbarn hat. Und bei jeder Art von Trainer sollte man nicht nur bedenken, dass der Trainer selbst Geräusche entwickelt sondern auch die Bewegungen und Vibrationen wiederum Körperschall erzeugen, der sich über Wände, Böden und Decken in alle Richtungen verteilt. So kann es passieren, dass es für einen selbst im Raum gar nicht so laut ist, bei den Nachbarn allerdings ein lästiges und lautes Dröhnen entsteht.
Direct Drive-Trainer (Wahoo Kickr)
Am anderen Ende der Produktpalette steht der Wahoo Kickr, der mit diesem Jahr in einen neuen Produktzyklus eingetreten ist. Er ist der klassische Vertreter der Trainer mit "Direct Drive". Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass das eigene Rad ohne hinteres Laufrad direkt in den Trainer eingespannt wird. Die Kraftübertragung erfolgt damit von der Kette des Rads direkt auf den Widerstand des Rollentrainers, mit dem Ergebnis, dass Tempo- und Wattwechsel schnell und direkt spürbar sind und das allgemeine Fahrgefühl besser wird. Außerdem reduzieren sich dadurch etwaige Reibungsverluste im System - so kommt die ganze Kraft aus den Muskeln auch tatsächlich bei der Walze an - der größte Vorteil von Direct Drive!
Vorteile bestehen demnach in der Kraftübertragung, der Direktheit, dem schnellen Ansprechverhalten bei Tempowechseln und dem generell höheren Leistungsvermögen der Rolle. Es sind weniger Teile in Bewegung (das komplette hintere Laufrad fällt weg), damit reduziert sich auch der Verschleiß an Teilen des eigenen Fahrrads. Auch durch die hochwertige Ausgestaltung des Widerstands läuft der Direct Drive-Trainer in der Regel bedeutend leiser als ein Modell, bei dem man das gesamte Rad einspannt. Wahoo hat hier mit dem Kickr über die letzten Jahre erstaunliches geleistet und so kommt die aktuelle Iteration des Wahoo Kickr mit einem derart leisen Betriebsgeräusch daher, dass man teilweise schon glauben könnte, es bewegt sich dort unten gar nichts... Je nach Intensität und Leistung ist das Laufgeräusch der Kette am eigenen Rad lauter als das Betriebsgeräusch des Trainers.
Dem aktuellen Kickr-Modell wurden als Sahnehäubchen noch bewegliche Füße gegönnt, die eine größere seitliche Bewegung des Rads erlauben und so ein noch realistischeres Fahrgefühl ermöglichen. Nicht ganz das, was man mit einer "Roller Plate" oder "Swing Plate" erreichen würde, wo sich ja tatsächlich das ganze System neigt und bewegt und auch nicht dasselbe wie die "Road Feel"-Funktion von Tacx aber eben eine gewisse Flexibilität in Seitenrichtung. Positiver Nebeneffekt: Damit hat auch das Rad etwas mehr "Bewegungsspielraum", was vielleicht jene Zweifler etwas beruhigen wird, die sich um ihren Untersatz Sorgen machen. (Obwohl ich persönlich keinen Fall kenne, bei dem ein (Carbon-)Rahmen auf der Rolle Schaden genommen hätte).
Das alles hat allerdings seinen Preis und die Anschaffung eines Direct Drive-Trainers will dann auch dementsprechend überlegt sein. Wer jedoch regelmäßig trainieren oder an der Genauigkeit und Direktheit seine Freude haben möchte, der wird um einen Direct Drive-Trainer wie den Kickr nicht herumkommen. Und auch die Nachbarn daneben und darunter werden ihre Freude haben.
Wahoo Kickr Core
Wer auf die Leistungsfähigkeit eines Direct Drive-Trainers nicht verzichten möchte, jedoch nicht das letzte Quäntchen aus sich und dem Trainer (und seiner Geldtasche!) ausreizen möchte, findet vermutlich in der goldenen Mitte ein gutes Zuhause. Der Kickr Core vereint die positiven Eigenschaften des "großen" Kickrs (im Sinne eines Direct Drive-Trainers) und verzichtet dabei nur auf einige wenige Merkmale, die allerdings im Alltag eines Radsportlers verzichtbar sein dürften. Statt 2.200 kann der Core beispielsweise "nur" 1.800 Watt simulieren - das dürfte aber eher Andre Greipel oder Sam Bennett stören, weniger uns "Normalos". Auch die simulierbare Steigung ist beim Core mit 16% etwas geringer. Und während beim "großen" Kickr bereits eine Kassette montiert ist, muss man diese beim Kickr Core zusätzlich besorgen. Angesichts der Vielfalt der aktuell verfügbaren Antriebsgruppen ist es aber ohnehin meistens notwendig, die passende Kassette nachzukaufen.
Einziges tatsächliches Manko des Core ist aus meiner Sicht, dass sich dieser nicht zusammenklappen lässt. Während man Kickr Snap und Kickr verkleinern und (z.B. im Sommer) gut verstauen kann, benötigt der Kickr Core etwas mehr Platz.
Komplettes Trainingsbike (Kickr Bike)
Wer sich mit voller Hingabe dem Indoor-Training widmen will, der hat auch noch Training-Bikes als Option - zum Beispiel das Kickr Bike. Dabei bekommt man ein komplettes Ökosystem ins Wohn- oder Hobbyzimmer gestellt und muss sich eigentlich um nichts anderes mehr sorgen. Die Geräuschentwicklung ist ohne bewegliche Teile und dank voller Integration gleich Null. Das eigene Bike kann man getrost schonen und für Fahrten draußen reservieren. Es gibt kein Herumhantieren mit Schnellspannern, Steckachsen, Kassetten oder dergleichen. Im Fall von Wahoo bekommt man mit dem Kickr Bike auch die Climb-Funktionalität dazu, mit der sich das Rad entsprechend der gefahrenen Steigung mitbewegt. Zum Kickr-Bike gibt es allerdings so viel zu sagen, dass ich mir das lieber für einen eigenen Blogpost aufhebe - glücklicherweise steht ein solches nämlich gerade bei mir in der Wohnung! ;)
Fazit und Typenberatung
Wintertraining muss und soll nicht langweilig sein und mit den aktuellen Rollentrainern sind die perfekten Voraussetzungen geschaffen, dass man entspannt und gut unterhalten durch den Winter fährt und im Frühjahr gleich auf einen respektablen Trainingsstand aufbauen kann. Neben Wahoo gibt es mit Tacx und Elite noch die zwei anderen Großen, außerdem noch einige weitere kleinere Hersteller von Smart-Trainern, die man sich jedenfalls genauer ansehen kann. Nicht-smarte Trainer gibt es auch noch auf dem Markt, allerdings spielen die tatsächlich nur noch eine untergeordnete Rolle und wenn man einmal in die Spielereien der smarten Welt hineingeschnuppert hat, möchte man eher nicht wieder zurück. Und ja, auch die freie Rolle gibt es natürlich noch - aber die war immer schon eine Geschichte für Spezialisten, sei es auf der Bahn oder für die Schulung eines schönen und runden Tritts (oder Videos auf Instagram, in denen man freihändig etwas kocht oder ein Instrument spielt, während man auf dem Rad sitzt...).
Die eigenen Anforderungen und die Geldbörse bestimmen am Ende, welches Modell am besten geeignet ist:
- Wechselt man oft zwischen Rädern oder benützt auf unterschiedlichen Rädern unterschiedliche Antriebssysteme, ist ein Wheel-On-Trainer naheliegend - auch wenn die Genauigkeit des letzten Watts nicht so wichtig ist.
- Bei wem Präzision und Leistungsvermögen an erster Stelle steht, ist mit einem Direct Drive-Trainer am besten bedient. Nirgendwo sonst bekommt man derart direkte Kraftübertragung und Direktheit bei einem gleichzeitig sehr leisen Betriebsgeräusch.
- Für einen Großteil der Nutzerinnen und Nutzer wird dann aber die "günstigere" Variante ausreichen, die mit ihrem Funktionsumfang so gut wie alle Anforderungen erfüllt, die man an einen Direct Drive-Trainer stellen kann. Bei Wahoo ist das der Kickr Core (gegenüber dem Kickr), bei Tacx wäre es der Flux (mit dem größeren Bruder Neo).
Smarte Wheel-On Trainer wie der Wahoo Kickr Snap kosten um die 500 Euro, die "billigeren" Direct-Trainer um die 800 und die "großen" um 1.200 Euro. Und erstaunlicherweise ist es so, dass auch die großen Internethändler bei Smart Trainern nicht wirklich bessere Preise anbieten können. Man kann also in diesem Fall getrost beim Hersteller oder im Fachgeschäft des Vertrauens bestellen und kaufen. Derzeit ist das allerdings - ehrlicherweise - sowieso eine enge Angelegenheit, sind doch durch Corona und diverse Lockdowns sowohl die Lager der Hersteller als auch jene der Händler komplett leergeräumt.
Für den Kauf beim Händler spricht übrigens auch - und das muss hier leider ungeschönt erwähnt werden -, dass es unabhängig vom Hersteller doch vermehrt zu Reklamationen und Garantiefällen kommt, weil Dinge nicht 100%ig funktionieren. Woran das liegt, kann ich nicht sagen - sei es die schnelle Produktion mit überschaubarer Qualitätskontrolle, die kurzen Produktzyklen, die permanente Weiterentwicklung oder die technische Komplexität... Immer wieder liest und hört man von "Montags-Geräten", bei denen ein Austausch über den Fachhändler dann wohl auch angenehmer ist, als ein 25 Kilo schweres Paket über die Post an den Hersteller zurückschicken zu müssen...
Aber gehen wir vom Positiven aus und da heißt es nur noch umziehen, genug Trinkflaschen bereitstellen, das Fenster öffnen und loslegen! Ride On!
Video - Umrüstung auf Tubeless
Gemeinsam mit Sorin, dem Mechaniker von PBike, habe ich mein Gravelbike - das BMC URS 01 - auf Tubeless umgerüstet. Was man dafür braucht, welche Schritte notwendig sind und worauf man achten muss, ist in diesem Video zusammengefasst. Nachdem ich euch nicht unnötig lange mit meiner Bob Ross-Erzählerstimme langweilen wollte, gibt es natürlich auch noch einige Informationen über dieses Video hinaus! Postet Fragen bitte gerne unter das Video, diesen Blogbeitrag oder auf einen der anderen Kanäle, ich werde mich bemühen, alle Fragen zu klären ;)
Ortlieb Bikepacking Taschen
Was haben meine Festive 500, die Bikepacking-Tour durch Österreich und die Race Around Austria Challenge Unsupported miteinander zu tun? Ja - lange Distanzen, Anstrengung und eine kleine Portion Masochismus. Aber auch die Bikepacking-Taschen von Ortlieb.
Begonnen hat es damit, dass ich für die Festive 500 im Winter ein "Notfallpaket" mit dabei haben wollte, das die Kapazitäten meiner Trikottaschen jedenfalls gesprengt hätte. Bei Pbike - dem Shop meines Vertrauens - war schnell eine Ortlieb Framebag besorgt und schon nach der ersten Ausfahrt war ich in das Teil verliebt - einfach anzubringen, wasserfest, robust und praktisch. In der Eiseskälte Osttirols waren im Frame-Pack immer Ersatzkleidung, Essen und Werkzeug dabei. Ich, der ich normalerweise ohne Taschen am Rad auskomme und über mehrere Jahre eine ausgeklügelte Raumaufteilungsstrategie für meine Trikottaschen entwickelt habe, war überrascht über die neue Freiheit, nichts am Rücken tragen zu müssen, alles dabei haben zu können und dabei auf nichts zu verzichten.
Mit der Umplanung des Jahres 2020 infolge der Corona-Pandemie ist bei mir dann - wie bei so vielen anderen auch - Bikepacking als wunderbare Alternative aufgekommen. Es war schon lange auf meiner To-Do-Liste aber Wochenenden während des Sommers waren schon in den vergangenen Jahren meistens immer für Events, Rundfahrten oder Marathons "blockiert". Für meinen Bikepacking-Ausflug hat die Ortlieb-Rahmentasche dann auch entsprechend Zuwachs bekommen - eine Satteltasche, die Lenkerrolle plus zusätzlicher Add-On-Tasche und die kleine Oberrohr-Tasche. Vollgepackt war ich damit durch Österreich unterwegs - während ich wetterbedingt nicht meine ganze Ausrüstung zum Einsatz bringen konnte (und damit wohl auf einiges an Gepäck verzichten hätte können...), so war der Regen zumindest dafür gut, die Wetterbeständigkeit der Taschen zu erproben!
Und letztendlich noch die Race Around Austria Challenge, bei der ich ebenfalls mit Rahmen- und Oberrohrtasche unterwegs war. Nach langem Hin- und Herüberlegen war das für mich die ideale Kombination.
Foto: Race Around Austria
Die Ortlieb Taschen im Detail
Frame-Pack Toptube
Für mich das Herzstück des Setups ist die Rahmentasche. Diese wird unter dem Oberrohr ins Rahmendreieck gespannt, steht damit nicht im Wind und stört auch sonst in keinerlei Weise. Das Volumen gibt Ortlieb mit vier Litern an, tatsächlich passt recht viel hinein: Werkzeug, Schlauch, Regenjacke, Baselayer, Riegel und Gels, Wertsachen-Beutel oder aber auch sechs Flaschen Ensure-Flüssignahrung! ;)
Zu beachten ist, wie man die Tasche packt bzw. was man wohin steckt. Die Tasche besitzt keine Innenaufteilung oder innenliegende Fächer. Wirft man daher alles nur wahllos hinein, besteht die Gefahr von Klumpenbildung und die wiederum kann die Tasche so ausbeulen, dass man im schlimmsten Fall mit den Oberschenkeln daran streift. Aber es ist keine Wissenschaft… - einfach die Dinge zusammenrollen, überlegt verstauen und etwas Tetris-Skills anwenden, dann passt das alles gut!
Der Reissverschluss ist - zumnidest bei meinem Modell - schwergängig, ein irrtümliches Öffnen ist ausgeschlossen. Umgekehrt empfiehlt es sich jedenfalls stehenzubleiben, wenn man etwas aus der Tasche braucht - eine Bedienung während der Fahrt habe ich ausprobiert, empfehlen kann ich sie aber nur bedingt.
Die Befestigung im Rahmendreieck erfolgt einfach mittels Klettverschlüssen - drei am Oberrohr, jeweils ein zusätzlicher nach vorne zum Steuerrohr und einer nach hinten. Damit kann man alles auf so gut wie jeden Rahmen einstellen, einzig der vordere Klettverschluss wird etwas kurz, wenn - wie bei modernen Karbonrahmen mittlerweile üblich - ein sehr dickes Steuerrohr verbaut ist. Genauer hinsehen sollte man bei kleineren Rahmen. Hier kann es sein, dass sich bei montierter Rahmentasche keine oder nur noch eine Trinkflasche ausgeht. Kalkuliert man das von Beginn an ein, lohnt sich vielleicht eher ein alternatives Trinksystem - dann kann man auch gleich zur Rahmentasche greifen, die das gesamte Rahmendreieck ausfüllt.
Wie für alle anderen Produkte aus der Ortlieb-Bikepacking-Serie gilt, dass die Tasche wasserdicht ist - die Nähte sind versiegelt, das Außenmaterial abweisend. Schlaues Detail ist ein kleines Loch am Ende des Reissverschlusses, durch das man beispielsweise das Kabel des Lampen-Akkus stecken kann. Und der Griff des Reissverschlusses wird in einer passenden Lasche verstaut, so baumelt dieser während der Fahrt nicht herum oder kommt dem Oberschenkel in die Quere.
Handlebar-Pack
Die Lenkerrolle gibt es mit 9 oder 15 Litern Volumen. Wer mit dem Rennrad oder Gravel-Bike unterwegs ist, wird sich für die kleinere entscheiden (müssen), denn nur diese passt zwischen einen Rennrad- oder Gravellenker. Auch hier geht die Montage leicht von der Hand. Klett- und zusätzliche Klick-Verschlüsse werden am Oberlenker angebracht, für extra Halt sorgt ein Band um das Steuerrohr. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein kleiner Spacer aus Schaumstoff, der die Tasche vom Steuerrohr fernhält und so Kontaktpunkte und Reibung mit dem Rahmen reduziert. Befestigt man Lenkerrolle und Rahmentasche gleichzeitig, muss man darauf achten, dass sich die beiden Bänder ums Steuerrohr nicht in die Quere kommen bzw. überlegen, welche Tasche man unterwegs eventuell vom Rad abnehmen möchte, sodass man nicht jedesmal von Neuem die Befestigungen übereinander schlichten oder auseinander dividieren muss :)
Die neun Liter Volumen reichen für eine kompakte Isomatte und einen Schlafsack, die man eingerollt leicht in der Tasche unterbringen kann. Alternativ kann man natürlich auch Gewand dort unterbringen, alles was gut “stopfbar” ist. Beim Packen und Verschließen sollte man darauf achten, dass man zum Unterlenker hin noch etwas Platz lässt, damit man dort auch den Lenker gut greifen kann. Bei (Gravel-)Lenkern mit Flare ist das weniger ein Thema. Dort funktioniert auch das Aus- und Einpacken der Tasche besser wenn diese noch am Rad montiert ist. Bei einem konventionellen Rennradlenker muss man die Tasche in der Regel abnehmen um sie auszuräumen, da man die seitlichen Verschlüsse sonst nicht ausrollen kann.
Auch hier ist die Tasche absolut wasserdicht, die Roll-Verschlüsse an beiden Seiten sind abgedichtet und alles was in der Tasche ist, bleibt gut geschützt. Wer mit einer Lenkerrolle unterwegs ist, muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass diese “im Wind steht”, und zwar richtig. Der Luftwiderstand des Systems wird merklich erhöht.
Accessory-Pack
Wem der Luftwiderstand eh schon egal ist und noch zusätzlichen Stauraum benötigt, kann an der Lenkerrolle noch eine Zusatztasche anbringen. Diese ist mit den integrierten Ösen und Haken kinderleicht und schnell montiert (und unterwegs auch wieder abgenommen). Die Zusatztasche eignet sich daher sehr gut für jene Dinge, die man eher schneller zur Hand oder immer bei sich haben möchte.
Der Verschluss der Tasche erfolgt mit einem zentralen Gurt in der Mitte der Tasche. Das ist einfach in der Handhabung, erfodert aber viel Sorgfalt beim Einrollen des Obermaterials - bei mir waren fast immer unschöne Ecken vorhanden, die dann nach oben wegstehen. Ehrlicherweise habe ich das aber bis dato nur im Stehen ausprobiert - für meine Touren war die Tasche bis jetzt noch nicht im Einsatz, weil ich den zusätzlichen Stauraum nicht gebraucht habe.
Seat-Pack
Die klassische Satteltasche gibt es ebenfalls in zwei Größen: 11 oder 16,5 Liter, wobei die größere zwei (statt einem) Befestigungsgurte hat und zusätzlich elastische Gummizüge an der Oberseite, um zum Beispiel leichte Schlapfen oder Flip-Flops zu befestigen. Ich persönlich bin ja kein Freund von allzu großen und weit ausladenden Satteltaschen, weil diese beim Fahren und vor allem im Wiegetritt zum Schwanken neigen. Für mich reicht daher das kleinere Modell mit elf Litern aus, wobei das schon eine beträchtliche Menge ist und die Tasche mit den diversen Gurten sehr gut anpassbar ist auf die jeweilige Beladung. Benötigt man nur den halben Stauraum, zurrt man die Tasche einfach auf die halbe Größe zusammen. Besonders schlau finde ich den verschließbaren Luftauslass an der Oberseite - diesen öffnet man vor dem Packen, dann räumt man seine Habseligkeiten in die Tasche, verschließt sie, drückt noch einmal alles fest zusammen und hört zu, wie die Luft aus dem Ventil entweicht. Auf diese Weise erhält man eine kompakte Satteltasche, die eben möglichst klein baut und dadurch nicht unnötig Schwungmasse aufbauen kann.
Der Verschluss wird eingerollt und zugeklippt, dadurch ist auch dieses System wasserdicht. Reflektoren an der Rückseite bieten zusätzliche Sicherheit und an den Schlaufen an der Rückseite lässt sich ein Licht montieren.
Cockpit-Pack
Am vielseitigsten und alltagstauglichsten wäre prinzipiell die kleine Oberrohrtasche namens “Cockpit-Pack”, leider ist diese aber auch der schwächste Teil der Serie (ausgehend von einem hohen Niveau allerdings). Zwei Dinge stören mich an der kleinen Tasche, die an sich ein perfekter Begleiter wäre - wasserdicht, kompakt und griffbereit. Zum einen ist da die Befestigung, die nicht so optimal funktioniert wie bei den anderen Taschen. Ein Klettverschluss um das Oberrohr sowie ein weiterer um das Lenkrohr bzw. die Spacer unterm Vorbau sollen die Oberrohrtasche an ihrem Platz halten. In der Praxis war der feste Halt allerdings nicht immer gewährleistet - nicht dass die Tasche runterfallen würde sondern dass sie leicht schief stand oder etwas zur Seite kippte. Das ist dann auch tatsächlich deswegen ein Problem (und das ist der zweite Punkt). weil die Tasche durch ihre Form sehr breit ist und bei einer leichten Schrägstellung dann die Oberschenkel die Tasche berühren. Das kann beim Fahren stören - bei meiner Österreich-Runde war das beispielsweise im Wiegetritt der Fall, weil ich dabei das Rad seitlich hin und her bewege. Was die Befestigung betrifft, so hätte mein Gravel-Bike am Oberrohr sogar zwei Schrauben, an denen man noch Zubehör montieren könnte, aber offenbar gibt es hier in der Industrie noch keine Verständigung auf eine gemeinsame Vorgehensweise - vielleicht werden wir hier für bestimmte Segmente in naher Zukunft einen Standard sehen.
Die Tasche selbst ist in Bezug auf Qualität und Verarbeitung einwandfrei - wasserdicht, mit einer hohen Gummilippe am Verschluss und einem Reissverschluss, der auch während der Fahrt bedient werden kann. Ein iPhone passt mit Ach und Krach gerade noch hinein, Riegel, Gels und Kreditkartenetui und dergleichen aber jedenfalls sehr gut. Bei meinen Erkundungen waren dort außerdem diverse kleine Kabel und Adapter verstaut, die ich gegebenenfalls schnell bei der Hand haben wollte und die ich nicht endlos in den Untiefen der größeren Taschen suchen wollte.
Einen Vielseitigkeits-Sonderpreis verdient das Cockpit-Pack für die Möglichkeit, auch als Satteltasche verwendet werden zu können. Bei einem Mountainbike-Urlaub in Osttirol hatte ich keinen Flaschenhalter am Rad (nicht fragen warum…), die Flasche wandete kurzerhand in die Trikottasche, das Werkzeug und die Jacke von ebendort direkt in die unter dem Sattel montierte Oberrohrtasche. Michael von Starbike ist mit diesem Setup sogar sein Race Around Austria so angegangen.
Meine Erfahrungen und was ich wofür verwende
Jede*r packt anders und das ist auch gut so, ist es doch auch eine recht individuelle Sache. Ich für meinen Teil richte mich natürlich nach der Herausforderung und dem Projekt. Als erstes schnalle ich die Rahmentasche aufs Rad, danach zusätzlich die Oberrohrtasche. Das ist für mich ein Setup, das das Verhalten meines Rades nicht bis wenig beeinflusst. und dabei kann man trotzdem das Wichtigste mit sich führen. Schließlich bin ich so auch meine Race Around Austria Challenge gefahren. Danach schnalle ich die Rahmentasche auf die Sattelstütze, diese bietet viel zusätzlichen Stauraum und durch die flexibel Größe auch eine gute Variabilität. Erst wenn die Satteltasche voll oder zu schwer wird, würde ich zur Lenkerrolle greifen. Bei der Lenkertasche ist der zusätzliche Luftwiderstand doch so spürbar, dass ich diese erst als “last resort” verwenden würde.
Was man wo hineinpackt, auch darüber lässt sich vortrefflich diskutieren und es wird auch hier individuelle Vorlieben geben. Eine gemeinsame Sichtweise ist aber insoweit vorhanden, als man üblicherweise schwere(re) Dinge in die Rahmentasche packt, Schlafsack und Isomatte in die Lenkerrolle und Gewand in die Satteltasche. Wertsachen sind üblicherweise in einer Oberrohr- oder Zusatztasche gut aufgehoben.
Bei meinen Touren mit den Ortlieb-Taschen war das Wetter jeweils recht “bescheiden”, von daher kann ich jedenfalls die Wasserfestigkeit der Produkte bescheinigen. Bei der Oberrohrtasche bürge ich auch für eine Wasserdichtheit, wobei diese weniger vom Wetter selbst auf die Probe gestellt wurde sondern eher durch sturzbachartige Schweißströme von meinem Kopf und Oberkörper.
Die Qualität ist hervorragend und die Verarbeitung einwandfrei. Nichts ist unsauber vernäht, nichts steht weg oder ist im Weg. Die Montage ist eigentlich selbsterklärend, bei jedem Gurt und Klettverschluss ist klar, was dieser zu tun hat und wo dieser hingehört. Hängt man sich allerdings alle Taschen zugleich ans Rad, kann es schon einmal recht eng werden - da sollte man sich kurz Gedanken machen, in welcher Reihenfolge man was montiert und wo jeder Gurt am Ende liegen wird. Besondern rund ums Steuerrohr sammeln sich dann eine Vielzahl von Gurten und Verschlüssen. Auch die Positionierung von Radcomputer und Lichtern will überlegt sein - so ist logischerweise die Lenkerrolle jeder Lichthalterung unter dem Vorbau oder unter dem Computer-Mount im Weg.
Recht viele Gurte und Klettverschlüsse :)
Ortlieb liefert zu den Taschen auch diverse Ersatz- und Zusatzgurte mit. So kann man notfalls auch eine improvisierte Halterung oder Befestigung basteln. Umgekehrt sind die vorhandenen Gurte (vor allem an Lenkerrolle und Satteltasche) teilweise recht lang, sodass stellenweise nicht mehr ganz klar ist wo diese hingehören oder verstaut werden sollen. Das letzte was man möchte, sind schlackernde Gurte oder am Ende sogar Dinge, die sich in den Laufrädern verfangen können.
Ebenfalls ein Thema sind empfindliche Karbonrahmen, die eventuell durch die Befestigungsgurte der Taschen abgenützt oder sogar beschädigt werden könnten. Ortlieb selbst gibt an, dass die eigenen Produkte auch für Karbonrahmen und -sattelstützen geeignet sind. Ich selbst konnte an meinen Rädern keinerlei Abnützung oder Spuren entdecken. Die Klettverschlüsse und Gurte haben in der Regel eine “weiche” Seite, im Normalfall wendet man diese dem Rahmen zu und nicht den aufgerauhten Klettverschluss. Wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, kann unter den Befestigungen noch transparente Kleber anbringen, dann kommt der Rahmen gar nicht mehr mit den Taschen in Berührung.
Im “täglichen” Gebrauch wird vor allem die Rahmentasche für mich eine tolle Erweiterung bleiben, sobald das mitgeführte Gepäck die Kapazität der Trikottaschen übersteigt. Satteltasche und Lenkerrolle werden mich hingegen nur auf ausgedehnten Touren begleiten. Und von denen hab ich noch einige vor - bin ich doch gerade erst auf den Geschmack gekommen… ;)
Disclaimer
Handlebar-Pack, Accessory-Pack, Seat-Pack und Cockpit-Pack wurden mir von Ortlieb für diesen Test zur Verfügung gestellt.
Wattmess-Systeme
Mit schöner, unregelmäßiger Regelmäßigkeit gibt es hier einen Artikel zum Thema Wattmessung. Und obwohl ich mich nach wie vor kategorisch weigere, nach Trainingsplan zu trainieren und die angezeigten Watt auf meinem Computer eher zu meiner eigenen Unterhaltung dienen als zu tatsächlichen Trainingszwecken, prangen doch auf mittlerweile drei meiner Räder Wattmess-Geräte. Diese verrichten alle einen guten und ähnlichen Job, könnten aber im Detail nicht unterschiedlicher sein. Grund genug, kurz auf die unterschiedlichen Systeme am Markt einzugehen und aus meinem persönlichen Nähkästchen zu plaudern. Dementsprechend habe ich auch nichts abgewogen, verglichen oder Power-Kurven von verschiedenen Programmen und Geräten übereinander gelegt, um prozentuelle Abweichungen zu suchen. Wie gewohnt gibt es daher vielmehr eine subjektive Erzählung ein paar jener Dinge, die ich an den jeweiligen Geräten mag oder nicht mag, die gut funktionieren oder weniger.
Unterschiedliche Systeme
Die Kraft, die aufgebracht wird, um mit dem Rad vorwärts zu kommen, kann grundsätzlich an vielen Punkten gemessen werden. Je näher man dabei an der Kraftquelle (dem Fuß) ist, desto grundsätzlich besser. Idealerweise wird dir Kraft direkt gemessen, das heißt mittels Dehnmessstreifen oder dergleichen. Der Reihe nach sind das die Pedale bzw. deren Achsen (Garmin, Powertap, SRM Exakt, Favero Assioma), die Kurbelarme (Stages, Rotor, Shimano, Verve, 4iiii), der Kurbel-Spider (SRM, Quarq, Power2Max), die Tretlagerwelle (Rotor InPower) oder die Hinterrad-Nabe (Powertap).
Außerdem gibt es noch Systeme, die man an den Schuhen, den Schuhplatten, am Lenker (!) oder sonst wo befestigen kann - dass dort jedoch tatsächliche Wattleistungen ermittlet werden (können), ist manchmal eher zweifelhaft, deshalb möchte ich diese Systeme aussparen.
Zu Systemen am Hinterrad - der Powertap-Nabe zum Beispiel -, oder Rotor InPower-Systemen, die die Kraft an der Tretlagerwelle messen, kann ich mangels Erfahrungswerten nichts sagen. Und wer nichts zu sagen hat, soll in den meisten Fällen lieber schweigen. ;)
Allgemeines
Es ist zugegebenermaßen etwas unübersichtlich geworden am Powermeter-Markt in den letzten Jahren. Gut, früher hat es SRM gegeben und Leistungsmessung war etwas für Profis. Mit der Demokratisierung der Leistungsmessung hat eigentlich Stages richtig begonnen, als vor einigen Jahren die linken Kurbelarme mit dem blauen Logo aufgetaucht sind, die um rund 700 Euro einen halbwegs leistbaren Einstieg in die Leistungsmessung ermöglichen sollten. Dass die Batteriedeckel der ersten Stages-Generation dabei jeden einzelnen Wassertropfen ins Innere gelassen haben war zwar ein Problem, aber der Weg war grundsätzlich bereitet. Maßgeblich für den Preisvorteil von Stages war zu dem Zeitpunkt natürlich, dass nur im linken Kurbelarm eine Messung eingebaut war, die Werte des linken Fußes einfach verdoppelt wurden, um die gesamten Watt dazustellen. Das Aufstöhnen der Puristen ob der Ungenauigkeit und Unwissenschaftlichkeit dieser Methode wurde recht schnell vom Verkaufserfolg von Stages überlagert.
An dieser Stelle möchte ich gleich meine persönliche Meinung zur Genauigkeit von Powermetern loswerden, die gleichermaßen übrigens auch für Indoor-Trainer gilt. Angegeben werden diese Abweichungen in Prozentschritten, wobei man bei 3% Abweichung oft schon den Eindruck erweckt bekommt, als würde die Welt untergehen. Bei meinen durchschnittlichen Wattwerten wäre eine Abweichung von 3% irgendetwas zwischen 5 und 7 Watt. Das mag nach viel klingen und für einen Profi, der auf 1-2 Watt genau trainieren soll, mag das auch noch relevant sein. Für mich ist das aber tatsächlich völlig vernachlässigbar. Ich möchte bei meinen Touren grob wissen, in welchen Zonen ich unterwegs bin und bei Intervallen oder Trainingsblöcken einen Anhaltspunkt für die zu erbringende Leistung haben. Dementsprechend halte ich es auch für übertrieben, extra Geld auszugeben für zusätzliche oder bessere Präzision. Das soll natürlich jede*r für sich selbst entscheiden und ein gewisses Grundmaß an Genauigkeit muss jedenfalls vorhanden sein. Man kann jedoch sehr wohl abwägen, ob man die Präzision eines teuren SRM-Powermeters (mit 1%) unbedingt benötigt oder ob Stages mit behaupteten 1,5% soviel schlechter ist.
Wichtiger sind da aus meiner Sicht andere Faktoren! Die Kompatibilität mit unterschiedlichen Head Units und damit verbunden die Kommunikationsmöglichkeiten des Powermeters - Bluetooth und/oder ANT+ zum Beispiel. Es soll nach wie vor Radcomputer geben, die nur entweder ANT+ oder Bluetooth aber nicht beides gleichzeitig können oder aber auch ganze Kanäle, die durch ein einziges Gerät blockiert werden und keine weiteren Verbindungen mehr zulassen (letzteres vor allem bei Hometrainern). Hier sollte man sich vor einem Kauf jedenfalls kurz schlau machen.
Stages hat mit der Messung auf der linken Seite zwar etwas losgetreten, bietet aber mittlerweile auch selbst beidseitige Systeme an. Die simple Verdopplung der Werte von einer Seite mag unseriös klingen, gibt aber grundsätzlich ein ganz gutes Gesamtbild ab. Dass mögliche Unschärfen - beispielsweise Dysbalancen und Links-Rechts-Unterschiede - auf diese Art und Weise noch verstärkt dargestellt und dadurch die Werte entsprechend ungenauer werden, ist evident. Massive Links-Rechts-Unterschiede sind den Sportler*innen, die es betrifft aber meistens ohnehin bekannt, weil da vermutlich Verletzungen oder Ähnliches vorangegangen sind. Für alle anderen Anwendungsfälle und bei geringfügigen Dysbalancen sollte dies aber kein gravierendes Problem darstellen.
Idealerweise ist ein Powermeter auch einfach zu bedienen und einfach zu nutzen. Moderne Räder sind ohnehin schon kompliziert genug und das Laden einer Di2-Batterie mutet in meinen Augen ja schon seltsam genug an - wie wenn das Rad ohne Steckdose nicht mehr funktionieren würde… Stromversorgung ist auch bei Powermetern ein großes Thema. Bei einigen Modellen kann man sich schon vorab auf einen massiv gestiegenen Verbrauch von CR2302 oder LR44-Batterien einstellen, andere Hersteller setzen auf praktische (aber fast immer proprietäre) Kabellösungen, auch die klassische AA-Batterie ist noch da und dort zu finden.
Ebenso “deppensicher” soll aus meiner Sicht die Anwendung sein - kein Kalibrieren vor jedem Losfahren, kein Anziehmoment für irgendwelche Schrauben, kein Einstellen von irgendwelchen Grundwerten! Aber damit sind wir schon mittendrin im ersten Praxisbericht…
1/ Garmin Vector
Wenn jemand am Boden liegt, soll man nicht auch noch drauftreten. Und Garmin hatte in den letzten Tagen mit den Problemen rund um Garmin Connect schon genug zu tun. Die “Begleiterscheinungen” der Garmin Vector Pedale waren allerdings von Anfang an schwer zu übersehen. Die an sich geniale Ansage war, Leistungsmessung in ein Pedal zu verpacken, das dementsprechend einfach und schnell von einem Rad aufs andere geschraubt werden kann - super zum Beispiel für das Leihrad im Urlaub oder das Bahnrad im Winter. Allerdings konnte die ersten Generationen der Vector-Pedale genau diese Einfachheit nicht wirklich einlösen. Für die Montage war ein exaktes Drehmoment einzuhalten und an den Achsen hing ein klobiger Pod für die Datenübertragung, der umständlich um das Kurbelende gelegt werden musste und nicht um alle Kurbeln passte.
Die dritte Generation hatte keine Pads mehr, dafür aber ein bedeutendes Problem mit dem Batteriefach - und ab hier kann ich aus persönlicher Betroffenheit berichten. Dabei hätten sich viele eine etwas bessere Kommunikationspolitik von Garmin gewünscht, denn es konnte keine zufriedenstellende Lösung für die mangelhafte Batteriefachabdeckung bereitgestellt werden. Und während dem Vernehmen nach rund 10 Prozent der Units nicht richtig funktionierten, wurden diese weiterhin verkauft und ausgeliefert. Umso überraschender war, dass im Frühjahr 2020 aus heiterem Himmel ein Mail eintrudelte, in dem der kostenlose Austausch der Batterieabdeckungen angeboten wurde. Man hatte mehrere Monate (!) für eine Neuentwicklung genützt, bei der nun verstärkte Kontakte eingesetzt werden und die Batterie stärker an den Kontakt gedrückt wird - Halleluja! Nach dem Einbau des neuen Deckels funktionieren die Garmin Vector Pedale nun (zumindest bei mir) genau so, wie sie sollen.
Der Wechsel zwischen mehreren Rädern funktioniert reibungslos und schnell - Drehmomentschlüssel und irgendwelche Pods sind jetzt nicht mehr notwendig. Die Batterielaufzeit (mit vier LR44-Zellen) ist gut und übertrifft bei mir die von Garmin genannten 120 Stunden bei weitem. Außerdem gibt es einen dezenten Warnhinweis (auch am Wahoo-Computer), bevor die Energie der Batterien endgültig zur Neige geht. Die Vector-Pedale sprechen Bluetooth und ANT+, Firmware-Updates und dergleichen funktionieren über die entsprechende App am Mobiltelefon.
Verwendet man einen Garmin Edge-Radcomputer der Serien 500, 800 oder 1000 kommt man außerdem noch in den Genuss der sogenannten Cycling Dynamics. Dabei werden in aufwendigen Diagrammen und Abbildungen direkt am Computer unterschiedliche Dynamiken dargestellt - darunter die Verteilung des Drucks am Pedal und der dazugehörige Offset von der Mitte, eine Darstellung der Druckphase in der Pedalumdrehung oder eine Erkennung, ob man sitzend oder stehend fährt. Das Ganze ist zwar nett anzuschauen, es fehlen allerdings die konkreten Schlüsse, die man aus diesen Daten ziehen soll. Auf diese Weise entsteht also recht viel Datenmaterial, mit dem man allerdings nicht allzu viel anfangen kann, außer dass es ganz nett aussieht. Auch unter dem Titel Cycling Dynamics läuft die Trittfrequenzmessung, die mit den Vector-Pedalen miterfasst wird - in diesem Fall wiederum sehr sinnvoll!
Die Garmin Vector Pedale gibt es um 500 Euro für die einseitige Messung (am linken Pedal) oder beidseitig um 900 Euro. Die mitgelieferten Pedalplatten sind Look-Standard - auch das ist zu bedenken, wenn man sich für ein System entscheidet. Bei mir waren die Vector-Pedale der Grund, warum ich bei allen Schuhen und (Renn)Rädern auf Look-Platten gewechselt habe.
2/ Stages
Stages war mein erster Powermeter - ich war quasi ein Teil jener Kundenschicht, die auf einen günstigeren Einstieg in die Leistungsmessung gewartet haben. Im Sommer 2016 hab ich einen linken Stages-Kurbelarm auf mein damaliges Canyon geschraubt und bin dadurch zwar keine Sekunde schneller gefahren oder habe keinen Platz dazugewonnen, aber es war hochinteressant, einen Wert zu haben, an dem man sich orientieren kann - egal ob es heiß ist oder kalt, ob man Hunger hat, gut drauf ist oder schlecht. Es gefiel mir von Beginn an, zu wissen, woran man ist - und das ist auch bis heute meine Grundmotivation in Bezug auf Leistungsmessung.
Mein Stages-Kurbelarm war einer der zweiten Generation und hatte dementsprechend schon die Kinderkrankheiten der ersten Generation (den undichten Batteriedeckel) abgelegt. Die Leistungsmessung funktionierte einwandfrei und stabil, einige kleine Aussetzer gehörten damals zwar auch mit dazu, diese waren aber nicht allzu störend. In den Tiefen des Internets findet man Vermutungen, dass die Sendeleistung der Stages-Kurbelarms nicht die beste sein soll oder es zumindest (bis Generation 2) war. Denn auch auf meinem aktuellen Rennrad habe ich eine Stages-Kurbel montiert - wiederum den linken Arm - und dort funktioniert die Messung seit Beginn problemlos und ohne Lücken.
Stages selbst spricht von einer Messgenauigkeit von +/- 1,5 Prozent - ein Wert, den ich weder überprüfen kann noch will. Auch wenn der Wert “falsch” wäre… Solange er immer gleich falsch ist, stimmt zumnidest der Informationsgehalt halbwegs und man kann sich daran orientieren. Während bei meiner ersten Stages Kurbel noch ein Haufen Knopfzellen daran glauben musste - der Batteriewechsel erfolgte gefühlt wöchentlich - halten die Zellen jetzt bedeutend länger durch. Die von Stages genannten 200 Stunden Minimum dürften wohl ungefähr stimmen.
Ansonsten ist der Stages bis auf das kleine Logo am Kurbelarm so gut wie nicht erkennbar, die kleine Ausbuchtung aus Kunststoff an der Innenseite des Kurbelarms ist nur beim genauen Hinsehen erkennbar, die 20 Gramm zusätzliches Gewicht sind vernachlässigbar. Auch hier sind sowohl Bluetooth als auch ANT+ an Bord, auch für Stages gibt es eine dazugehörige App für Firmwareupdates und dergleichen. Wie schon zuvor ist auch bei Stages die Trittfrequenzmessung mit an Bord.
Obwohl Stages mit der einsetigen Messung begonnen hat, gibt es mittlerweile beidseitige System oder auch nur den rechten Kurbelarm (mit Kettenblättern). Die Version der Messung nur auf der rechten Seite ist in erster Linie für Zeitfahrräder oder spezielle Bauformen (unter anderem Direct Mount-Bremsen unten am Rahmen) gedacht, wo tatsächlich nicht genug Platz für den wenige Millimeter hohen Pod am linken Kurbelarm ist.
Gab es zuerst nur Shimano Kurbelarme, ist das Sortiment mittlerweile rieseig und umfasst Shimano, SRAM, Campagnolo, Cannondale, RaceFace, Easton und Specialized Kurbeln. Stages liefert sich außerdem immer wieder recht ambitionierte Preis- und Rabattschlachten mit den anderen Herstellern, dadurch kommt man bereits für 299 Euro in den Genuss einer Leistungsmessung (für den linken Kurbelarm der Shimano 105). Die restlichen linken Kurbelarme bewegen sich preislich irgendwo zwischen 400 und 700 Euro, die beidseitige Messung beginnt im Bereich von 700 Euro (Ultegra oder XT bspw. 749 Euro).
3/ Quarq
Mit dem Quarq Powermeter sind wir beim Kurbel-Spider angelangt. Quarq hat damit viel Erfahrung, werken sie doch schon lange Jahre an ihren Produkten - zuerst unter eigener Marke, seit 2012 unter dem Dach von SRAM, die dann auch die ersten waren, die Powermeter (optional) in ihre Top-Gruppen integrierten. Die Messung erfolgt am Kurbel-Spider - der Powermeter-Spider ersetzt hier mehr oder weniger komplett den originalen, die Kettenblätter werden am PM-Spider montiert. Der Austausch geht einfach von der Hand, der Ort ist für einen Powermeter ideal - nahe an der Kraftquelle, ohne große Eingriffe in bestehende Bauteile und auch nicht so exponiert wie beispielsweise Pedale. Auch der Markt- und Technologie Pionier SRM wählt seit jeher den Spider als Ort für die Messung der auftretenden Kräfte.
Quarq war von Anfang an im Konzert der preisgünstigeren Powermeter dabei, mit dem Nachteil der geringeren Kompatibilität bzw. der engen Verbindung mit SRAM-Komponenten. Dafür hat man den Eindruck, alles aus einer Hand zu bekommen. Und tatsächlich ist es auch im täglichen Betrieb so, dass sich der Quarq Powermter am “integriertesten” anfühlt. Sowohl was die Qualität des Produkts angeht als auch - und das ist noch wichtiger - im Sinne der Positionierung des Powermeters und der Art und Weise, wie er “fest” verbaut ist. Natürlich sind auch Kurbelarme und Pedale fest verschraubt, allerdings ist gefühlsmäßig der Kurbelspider ein noch fixerer Bestandteil des Rads, ist weniger exponiert, wirkt noch stabiler. Es ist dies ein subjektiver Eindruck und - offensichtlich - ist es schwierig, diesen Eindruck in Worte zu fassen… Der Quarq Spider wirkt am solidesten und das beruhigt.
Die Messgenauigkeit ist laut Hersteller bei 1,5 Prozent, die CR2302-Zelle hält rund 200 Stunden, Trittfrequenzmessung ist an Bord, kommuniziert wird über Bluetooth und ANT+ und für Firmware-Updates und dergleichen fügt sich der Powermeter in die SRAM-eigene “AXS”-Welt ein, in der man über eine zentrale App alles steuern kann - vom Powermeter über die Schaltung bis hin zur versenkbaren Sattelstütze.
Linkes und rechtes Bein werden getrennt voneinander ausgewiesen, wobei die Zugphase des einen Beins die Druckphase des gerade anderen ist. Die Links-Rechts-Verteilung kann dadurch natürlich geringfügig verfälscht werden, grundsätzlich geben Powermeter am Spider die L/R-Verteilung aber sehr gut wieder.
Der Einstieg in die Powermeter-Welt von SRAM kostet rund 550-600 Euro wenn man nur den Spider anschaffen möchte, bei höherwertigen Rädern ist der Powermeter mitunter schon mit am Rad verbaut, muss allerdings gegen eine Gebühr freigeschaltet werden.
Mein Fazit
Ich habe am liebsten Systeme, die einfach funktionieren. Ich möchte mich nicht unbedingt mit einer komplizierten Montage befassen, vor jeder Fahrt irgendetwas kalibrieren oder permanent Dinge aufladen müssen. “No nonsense” oder “just works”-Lösungen nennt man das wohl oft. In diesem Sinne ist mir von meinen Powermtern der Quarq am Zeitfahrer am liebsten, fühlt dieser sich doch irgendwie am “vollständigsten” an. Auf der anderen Seite haben mich auch die Stages Kurbel und die Garmin Pedale rein konstruktiv nie wirklich im Stich gelassen, da geht es eher um ein Gefühl der Integrität.
Sehr wohl im Stich gelassen haben mich Stages und Garmin zu Beginn beim Batteriewechsel. Während die zweite Stages-Generation Batterien im Akkord verbrauchte, ging nach dem Batteriewechsel beim Vector Pedal erstmal gar nichts mehr. Stages hat bei der 3. Generation nachgebessert, Garmin ebenfalls. Beide Systeme funktionieren an meinen Rädern einwandfrei und geben keinen Grund zur Klage. Was die Energieversorgung betrifft, wäre mir dennoch ein System lieber, das man mittels (USB-)Kabel aufladen kann - sowohl im Sinne der Usability als auch der ökologischen Nachhaltigkeit.
Zur Genauigkeit der Messung möchte ich mich nicht ausbreiten, dazu sind mir die ausgegebenen Werte nicht wichtig genug - im Sinne des allerletzten Prozents. Nach einer anfänglichen Kalibrierung (und nach jedem Batteriewechsel) geben alle drei Powermeter stabil ihre Werte aus. Gefühlt (und im Vergleich mit meinem Wahoo Kickr) gibt der Quarq die Werte am genauesten wieder, gefolgt von Garmin und mit etwas Abstand Stages. Beim Kurbelarm liegen meine Wattwerte grundsätzlich etwas über dem, was ich sonst trete.
Foto: Sportograf
Kaufentscheidungen?
Vor der Anschaffung eines Powermeters, kann man sich anhand einiger einfacher Fragen an ein passendes Modell herantasten bzw. einige Dinge schon einmal gut eingrenzen oder ausschließen:
Möchte ich den PM auf einem oder auf mehreren Rädern benützen?
Wo ist meine preisliche Schmerzgrenze?
Was fahre ich jetzt für ein Kurbelfabrikat und möchte ich dabei bleiben?
Welchen Achsstandard hat mein Rad?
Wie relevant ist die Genauigkeit der Messung für meine Zwecke?
Bin ich auf SRAM oder Shimano fixiert?
Beantwortet man diese Fragen ehrlich und für sich selbst, kommt man vermutlich schon zu einer Auswahl von nur noch zwei bis drei Fabrikaten und Produkten, die man sich dann näher anschauen kann. Der Zeitpunkt für eine Anschaffung ist derzeit nicht der schlechteste, nachdem sich einige Hersteller in eine neue Runde von Preisschlachten gestürzt haben. Power2Max fährt seit einigen Monaten bereits große Rabatte auf, Stages hat die Einstiegspreise ebenfalls massiv gesenkt.
Ob ein Powermeter Sinn macht, ist eine Entscheidung, die jede*r für sich selber zu treffen hat, Spaß machen sie aber auf jeden Fall. Und wenn es nur darum geht, beim King of the Lake den FTP-Wert auszuloten…!
Weniger Plastik dank Keego
Rahmenformen werden im Mikrometerbereich auf Aerodynamik hin optimiert, Trikotärmel bekommen Golfball-ähnliche Wabenstrukturen verpasst und Antriebsstränge werden verbessert, um unnötige Reibungsverluste zu reduzieren. So gut wie alle Bereiche des Radsports und des Radfahrens werden laufend gescreent, evaluiert und mit teilweise nicht ganz unbeträchtlichem Aufwand optimiert. In diesem Sinne mutet es mitunter etwas seltsam an, dass die Trinkflasche seit Jahrzenten nahezu unverändert ihr Dasein fristet - gefertigt aus schnödem Plastik, ab Werk mit einem strengen Geruch ausgeliefert, der nur nach und nach durch Residuen unzähliger Iso-Drinks unterschiedlicher Geschmacksrichtungen übertüncht wird.
Genau dort setzt Keego an, deren Gründer sich wohl ähnliche Fragen gestellt haben: Warum geben Radlerinnen und Radler tausende Euro für Rad, Kleidung und Ausrüstung aus, machen Ernährungsberatungen, Bikefittings und andere Anaylsen auf der Suche nach mehr Körperbewusstsein und Selbstwahrnehmung, nur um dann Getränke aus billigen Plastikflaschen zu trinken? Und nicht erst aktuelle Klima-Debatten haben die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Themen wie Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit oder Mikroplastik gelenkt.
Aus meiner persönlichen Sicht liegt einer der Hauptgründe in der “Beiläufigkeit” von Trinkflaschen im Profi-Radsport. Erst vor kurzem wurden Postings der großen Profi-Teams zuerst mit Wut bedacht, nachdem bekannt gegeben wurde, wieviel Plastikflaschen pro Jahr verbraucht werden (und danach großteils im Müll landen). Geklatscht wurde kurz danach, als einige Teams Besserung gelobt hatten. Fakt ist allerdings, dass dem Profi oder der Profi-Fahrerin auf dem Rad im Rennen herzlich egal ist, ob die Flasche nachhaltig ist oder länger hält - es geht hier rein um schnelles Reichen der Trinkflaschen und ebenso schnelle Entsorgung der leeren Bidons. Anders ist das für uns, die wir großteils zur Freude im Sattel sitzen, kein Begleitfahrzeug mit frisch gefüllten Flaschen hinter uns fahren haben und die Flaschen aus unserer eigenen Tasche bezahlen müssen.
Die Idee & Kampagne
Spulen wir die Zeit zurück zum 13. März 2018, als Keego-Founder Lukas auf Kickstarter verkünden konnte, dass bereits nach sechs Stunden das geplante Investitionsziel erreicht worden war. Auf dieses Update folgten noch mehrere dieser Art und am Ende standen über 215.000 Euro als Ergebnis da und das ursprüngliche Ziel war fast um das Zehnfache übertroffen. Alleine diese Zahl soll schon als indikator dafür dienen, dass es sich auszahlen sollte, die Trinkflasche als solches zu hinterfragen und neu erfinden zu wollen.
Was ist Keego? Die Idee war, eine Trinkflasche aus Metall zu fertigen, die geschmacksneutral ist, keine Gerüche annimmt und entsprechend pflegeleicht, gleichzeitig aber “squeezable” also zusammendrückbar ist. Die scheinbare Quadratur des Kreises also, die sich jeder, der schon einmal eine Sigg-Metallfalsche oder ähnliches in der Hand hatte, schwer vorstellen konnte.
Der typische und uns allen bekannte Plastikgeruch und im schlimmsten Fall auch - geschmack entsteht, wenn sich die Bestandteile des Plastiks sukzessive herauslösen und über den Inhalt der Flasche den Weg in unsere Körper finden. Dabei ist es fast schon egal, ob es um Weichmacher (sogenannte Phtalate) oder die bekannte Abkürzung “BPA” (Bisphenol A) geht oder ob man hormonelle Veränderungen, Diabetes oder andere mögliche Auswirkungen heraufbeschwört. Fakt ist, Plastik ist nicht der ideale Aufbewahrungsort für Flüssigkeiten, umso mehr, als darüber auch entsprechende Leistung abgerufen und unterstützt werden soll. (An dieser Stelle sei außerdem noch angemerkt, dass das Prädikat “BPA-frei”, das mittlerweile viele Produkte ziert, keine Garantie für eine entsprechende Unbedenklichkeit darstellt.)
Eine Keego-Trinkflasche hingegen besteht zu 99,8 Prozent aus Titan. Dieses Material ist nicht nur beständig und leicht sondern reagiert auch nicht auf äußere Einflüsse - das ist auch der Grund, warum Titan oft für Implantate und dergleichen verwendet wird. Dazu kommen Korrosionsbeständigkeit, Schimmelresistenz und eine entsprechend leichte Reinigung!
Ein steiniger Weg
Nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne kamen allerdings erstmal eine Reihe von Rückschlägen. Während Konstruktion und Materialen klar waren, konnte zuerst kein Unternehmen gefunden werden, dass die Flasche nach den Vorgaben herstellen wollte oder konnte. Spezialisierte Industrieunternehmen unterbrechen dann doch nicht so gerne ihre industriellen Regelprozesse, um Ideen kleiner Start-Ups auszuprobieren. Und um sich besser vorstellen zu können, dass nicht unbedingt der Handwerksbetrieb von nebenan in der Lage ist, eine Keego-Falsche herzustellen, sei gesagt, dass man letztendlich mit einem Unternehmen zusammenarbeitete, das üblicherweise Komponenten für den CERN-Teilchenbeschleuniger herstellt.
Neben der eigentlichen Fertigung traten zusätzlich noch Schwierigkeiten mit dem Außen-Finish der Flasche auf - der Lackierer verlangte plöotzlich den doppelten Betrag für die Fertigung und die Zeiträume konnten nicht mehr garantiert werden. Das Projektteam von Keego änderte hier kurzerhand die Zusammensetzung der Flasche und auch dieses Problem war gelöst. Gleichzeitig stiegen allerdings Druck und Erwartungen jener Kunden, die das Projekt auf Kickstarter unterstützt hatten und nun schon mehrere Monate auf ihre Flaschen warteten.
Das fertige Produkt (1.0)
Schließlich trudelten im Herbst 2018 bei mir zuhause zwei “Early-Bird”-Flaschen ein, als Ergebnis meiner Unterstützung der Kickstarter-Kampagne -in schönem Silber gehalten mit blauen Akzenten am Verschluss und den Keego-Schriftzügen. Die Lieferung erfolgte nachhaltig in Kartons, die - und das war natürlich auch der erste und wichtigste Test in der Sekunde des Auspackens! - der einzige Geruch waren, der zu vernehmen war. Die Absenz von Plastikgeruch war eine unmittelbare Bestätigung dafür, dass hier offensichtlich jemand etwas richtig gemacht hat.
Beim Blick in die Flasche schimmert das Metall, es handelt sich um eine mehrschichtige Konstruktion von dünnen Titanplatten, die außen mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen sind. Metall auch an der Außenseite hätte für die Trinkflasche nicht die gewünschte Widerstandsfähigkeit geboten. Außerdem sichert der Kunststoff außen auch den sicheren Halt in Flaschenhaltern am Rad. Die Form weicht von bekannten Trinkflaschen etwas ab. Keego liegt etwas größer in der Hand, die Dimensionen sind allerdings den besonderen Materialeigenschaften geschuldet - Druckverteilung, Materialspannung und der Wunsch, Metall zusammendrücken zu können haben hier zu “form follows function” geführt.
Verschluss und Ventil sind aus Kunststoff bzw. Silikon gefertigt, hier gibt es leider keine Alternativen. Ist das Mundstück hineingedrückt, kann die Flasche völlig auslaufsicher transportiert, geschüttelt und auf den Kopf gestellt werden. Beim Radeln oder vor der körperlichen Aktivität zieht man das Mundstück heraus - sobald man dann die Flasche zusammendrückt, öffnet sich das Ventil. Im Umkehrschluss tropfen und spritzen die Flaschen nicht, wenn es einmal etwas holpriger zugehen sollte.
750 Milliliter fasst die Keego-Trinkflasche und damit genau so viel, wie eine große Plastikflasche - die Unterscheidung dort lautet meist klein (=500 ml) oder groß (750 ml). Und trotz des vermeintlich schwereren Materials wiegt Keego nur 92 Gramm und damit nur wenige Gramm mehr als die vergleichbare Plastikflasche.
Serie 1 der Keego-Flaschen hatte allerdings ein gröberes Problem: Man musste unverhältnismäßig viel Kraft aufwenden, um die Flaschen zusammenzudrücken. Und ohne den notwendigen Druck - und das war ja auch am Mundstück so beabsichtigt -, kam keine Flüssigkeit aus der Flasche. Nun habe ich vergleichsweise große Hände und hatte dahingehend schon leichte Vorteile, die große Flasche entsprechend zu quetschen. Dennoch möchte man sich auf Ausfahrten oder gar in Rennen nicht sonderlich intensiv mit dem Zusammendrücken der Flasche befassen, das sollte schon nebenbei und ohne große Anstrengung vonstatten gehen können.
Der Hauptgrund, warum man sich eine Flasche aus Metall zulegt, konnte von Keego allerdings voll und ganz erfüllt werden. In mehreren Monaten der Verwendung konnte sich zu keinem Zeitpunkt irgendein Geruch oder Geschmack festsetzen, die Reinigung ging leicht von der Hand und bis auf ein paar Kratzer an der Außenseite (die üblichen Abnützungserscheinungen vom Flaschenhalter) war der Keego nichts anzusehen.
Die Evolution (2.0)
Ende 2019 fand schließlich eine - diesmal schwarze - Flasche aus der neuen Charge den Weg zu mir (ich nenne sie hier mal Version 2.0). An den grundsätzlichen Eigenschaften hat sich nichts geändert, allerdings schaffte es die Keego-Crew, die Flasche leichter quetschbar zu machen. Und diese Änderung ist deutlich spürbar - man muss nun nicht mehr sämtliche Kraft dafür aufwenden sondern einfach und normal zudrücken, wie man es bei jeder anderen Flasche auch tun würde. Womit der größte bisherige Kritikpunkt an Keego aus meiner Sicht souverän ausgeräumt ist.
Ah, Moment - da war noch ein Kritikpunkt! Eine Keego-Flasche ist mit einem ambitionierten Preis von 59 Euro veranschlagt. Das ist rund das Dreifache einer Standard-Plastiktrinkflasche aus dem Handel, rund das Zehnfache einer gesponserten Trinkflasche, die man zu einem Set Riegel und Pulver dazubekommt und um ein unendliches mehr als eine Gratis-Trinkflasche, die man häufig in einem Startbeutel eines Radmarathons findet. Nun wird dieser stolze Preis für viele ein Dealbreaker sein und trotz Liebe zum eigenen Körper, Gesundheitsbewußtsein, Leistungsgedanken und anderen Argumenten für ein neutrales Material wird man schlucken. In meinen Augen wird es eine bewusste Kaufentscheidung sein, für Nachhaltigkeit und Gesundheit. Wer - so wie ich - kein sonderlich pedantischer Reiniger seiner Trinkflaschen ist, wird die Einfachheit der Reinigung hoch schätzen. Wer einmal selbst erlebt hat, was es bedeutet, wenn die Flasche überhaupt nicht nach Plastik riecht oder schmeckt, wird das nicht mehr missen wollen. Wer einen nachhaltigen Lebensstil pflegt und vielleicht auch für den Alltag eine Trinkflasche aus Metall verwendet (die dann vermutlich auch rund 40-50 Euro gekostet hat) wird die Sinnhaftigkeit einer derartigen Investition auch im Sport verstehen. Und schließlich geht es - so wie immer - auch ein bisschen um Individualität und darum, eben nicht mit der Gratis-Trinkflasche vom letzten Marathon herumzufahren.
Das Fazit
Ich hatte nun insgesamt drei Keego-Flaschen im Einsatz, zwei davon über ein Jahr lang. Die versprochene Geschmacks- und Geruchsneutralität kann Keego jedenfalls einlösen. Auch mit wenig oder nicht sehr gründlicher Pflege sind die Flaschen innen in einem makellosen Zustand, nichts haftet, nichts klebt, nichts ist zerkratzt. Auch der Geschirrspüler, der von Keego an sich nicht zur Pflege empfohlen wird, konnte meinen Flaschen bis jetzt nichts anhaben.
Ich habe die Flaschen mit purem Wasser verwendet, mit Iso-Drinks, mit Isodrinks, in die noch zusätzlich Gels reingedrückt waren und dann wieder mit purem Wasser mit einer Messerspitze Salz. Trinken aus dem Bidon wird nie ein kulinarisches Fünf-Sterne-Erlebnis sein, aber zu wissen, dass Wasser wirklich nur nach Wasser schmeckt, ist für mich schon großartig genug. Wer viel unterwegs ist, eventuell unterschiedliche Produkte in die Flaschen füllt oder zur Reinigung nur kurz ausspülen möchte, wird mit Keego glücklich werden. Was in keinem Test und auf keiner Homepage steht, ist, dass Flüssigkeiten in der Keego-Flasche gefühlt etwas länger kühl bleiben. (Vielleicht steht es aber auch nur nirgends, weil ich es mir nur einbilde…)
Die Haltbarkeit wird von Keego mit mindestens drei Jahren angegeben. Wenn ich überlege, wie meine Plastikflaschen nach einem halben Jahr intensiven Gebrauchs aussehen, reicht mir diese Lebensdauer auf jeden Fall aus, wenn die Keego-Flaschen ihre guten Produkteigenschaften über diesen Zeitraum erbringen können.
Die schlechte “Quetschbarkeit” ist seit Version 2.0 kein gültiges Argument mehr gegen eine Keego, bis auf den Formfaktor gibt es keine wesentlichen Unterschiede zu einer herkömmlichen Plastikflasche. Es werden mittlerweile mehrere Farb-Varianten angeboten, für Firmen und Vereine gibt es außerdem die Möglichkeit, Keego-Flaschen entsprechend branden zu lassen.
Bleibt der Preis als letzter potentieller Dealbreaker. Dieser ist nicht schönzureden oder wegzudiskutieren, wer allerdings die Geschichte hinter dem Produkt kennt, den Produkteigenschaften entsprechende Wertigkeit einräumt und sein reines Wasser aus einem nachhaltigen und in Europa gefertigten Produkt konsumieren will, der schaut sich Keego am besten mal etwas genauer an.
PS: Für meine “Race Around Austria Challenge Unsupported” habe ich vor, mit Keego-Flaschen an den Start zu gehen. 1. bieten mir diese mit in Summe 1,5 Litern ein größeres Volumen als meine bisherigen Flaschen und 2. werde ich in diesen 24 Stunden so viele Pulver, Gels und was auch immer in diese Flaschen füllen, dass es nur gut ist, wenn man diese mit einem Schwapp Wasser schnell und einfach ausspülen kann!
Satteldruckanalyse bei PBike
Auf dem Bildschirm vor meinen Augen bewegt sich eine undefinierte blaue Fläche, an manchen Stellen verfärben sich Teile grün, da wird ein Punkt gelb, dort einer sogar kurz rot. Mein Rad ist bei PBike neben der Bikefitting-Station eingespannt und ich trete gemütlich in die Pedale - in Oberlenkerposition, auf den Hoods und im Unterlenker. Die farbige Fläche geht von meinem Allerwertesten aus, mein Sattel ist mit einem intelligenten “Überzieher” ausgestattet, der jeden Druckpunkt, jede Bewegung und jede Veränderung penibel registriert und auf dem Bildschirm anzeigt.
Unter Druck!
Dass man sich heutzutage zu einem Radkauf (zumindest ab einer gewissen Preisklasse) ein Bikefitting gönnt, ist beinahe schon selbstverständlich. Und das ist gut so, schließlich entbehrt es einer gewissen Logik, sich um mehrere tausend Euro ein Sportgerät zu kaufen und dann darauf zu verzichten, es richtig einstellen zu lassen. Das Thema Bikefitting haben wir vor einiger Zeit schon ausführlicher gehabt (und es wird in den nächsten Wochen ein Update geben!), im Wesentlichen geht es dabei aber um die richtigen Einstellungen am Rad, um dieses an den eigenen Körper, die gewünschte Fahrweise und an anatomische oder medizinische Rahmenbedingungen anzupassen. Sattelpostition und damit eng verbunden Sitzposition sind in diesem Spiel wichtige Komponenten und oft ist der Hintern der Radlerin und des Radlers die Schwachstelle. Fragt man schnell einmal in seinem Bekanntenkreis herum, wo denn am ehesten die Probleme liegen oder sogar Schmerzen auftreten, werden sich zwei Antworten herauskristallisieren: Hände oder Gesäß - sind das doch schließlich die zwei großen (statischen) Kontaktpunkte zwischen uns und dem Rad. Mit starker Überhöhung sind die Hände und Handgelenke starkem Druck ausgesetzt und damit potentiell gefährdet. Sitzt man hingegen sehr aufrecht auf dem Rad, steigt der Druck auf den Allerwertesten. Mit einem Bikefitting kann man entweder statisch oder aufgrund der Bewegungswinkel gut ausmessen und anschließend einstellen, wie man auf dem Rad sitzt und schon auf diese Weise mögliche Probleme im Ansatz vermeiden oder minimieren.
Was bei einem klassischen Bikefitting bis jetzt aber nur angenommen wurde - oder aufgrund technischer Rahmenbedingungen nur angenommen werden konnte - ist die Druckverteilung auf dem Sattel. Während die Sitzknochenvermessung - das ist jene Geschichte, bei der man sich auf einen Karton setzt und dann den Abstand zwischen den beiden Dellen abmisst - zwar Auskunft über eine mögliche Sattelbreite geben kann, ist damit noch lange nicht sichergestellt, dass man sich auf dem Sattel auch wohlfühlt und keine Druckschmerzen auftreten.
Auftritt Satteldruckanalyse! Wer schon einmal in einem guten Laufgeschäft war und sich dort einen Laufschuh gekauft hat, ist vielleicht schon über eine Druckmessplatte gelaufen. Bei Laufschuhen wird auf diese Weise ermittelt, wo die Auftrittspunkte beim Laufen sind, wie sich der Druck verteilt und welcher Schuh geeignet ist. Bei der Satteldruckanalyse passiert im Wesentlichen etwas Ähnliches.
Wie funktioniert die Satteldruckanalyse?
Man kommt mit seinem eigenen Rad, seinem Sattel und Radgewand - schließlich sollen die Bedingungen jenen entsprechen, die man auch am Rad vorfindet. Der Sattel bekommt sodann einen Überzieher, der auf den ersten Blick eher altbacken nach einer Regenhaube für den Sattel eines Stadtrades aussieht und so gar nicht nach hochtechnologischem Messverfahren aussieht. Dann tritt man in die Pedale, wobei es nicht um Watt oder Geschwindigkeit geht, sondern um jene Position, in der man in der Regel unterwegs ist.
Auf dem Bildschirm von Christoph beginnen sofort die ersten Farbflecken zu wabern. Grau bedeutet, dass dort kein Kontakt zwischen Körper und Druckmessfolie besteht, blau und grün stellen “normalen” Druck dar, gelb und rot entsprechend höheren. Im Idealfall pedaliert man so ein paar Minuten vor sich hin, damit das System einen guten Ersteindruck und damit auch Mittelwert generieren kann - die Erstmessung ist abgeschlossen.
Schon nach wenigen Minuten hat man auf dem Bildschirm bunt auf weiß eine Erklärung für das, was man am unteren Ende des Körpers - oder besser in der Mitte… - spürt. Es folgen weitere Sessions in anderen Griffpositionen - Hoods, Oberlenker, Unterlenker, Zeitfahrposition (oder wie ich sie nenne: die “Tim Wellens-Position” mit den Unterarmen am Oberlenker aufgestützt). Je nach Griffposition ändert sich natürlich die Gewichtsverteilung zwischen Händen und Gesäß und die Sitzposition im Sattel. Die Druckverteilung und die bunten Felder auf dem Display wandern dementsprechend von vorne nach hinten (Oberlenker) und wieder zurück nach vorne auf die Spitze des Sattels (in Aero-Position). Wieder ist anhand der Farbcodes sofort erkennbar, wie groß die Druckspitzen sind, wo potentielle Problemstellen da sind.
Wer viel im Sattel sitzt und im Jahr mehrere tausend Kilometer abspult, hat im Normalfall ein gut ausgeprägtes Körperbewusstsein und “spürt sich” ganz gut. Dementsprechend erinnert man sich auch an unterschiedliche Sättel, unterschiedliche Sitzpositionen und das eine oder andere Weh-Wehchen oder Problem, das im Laufe der Jahre aufgetreten ist. Im Rahmen der Satteldruckanalyse kann man diese Erinnerungen - fast schon spielerisch - reproduzieren. So werden beispielsweise Ausweichbewegungen sofort sichtbar, seitliche Dysbalancen, man sieht das Kippen des Beckens in seiner Richtung und Ausprägung - dem unscheinbaren Sattelüberzug auf dem eigenen Rad bleibt so gut wie nichts verborgen. Was sich nicht in Farbskalen darstellen lässt, erklärt Christoph anhand der Vielzahl von Daten, die ermittel werden und in einer der vielen Ansichten im Programm verfügbar sind. Flächen, Verteilungen, Maximalwerte, Mittelwerte, Verhältnisse…
Schön und gut, aber wozu das Ganze? Wenn man “seine” Sitzposition gefunden hat und beschwerdefrei unterwegs ist, warum dann die Büchse der Pandora überhaupt öffnen? Im Wesentlichen gibt es drei Anwendungsfälle, für die eine Satteldruckanalyse gut ins Konzept passt:
Bikefitting
Sattelkauf
Schmerzen
Schauen wir uns das kurz genauer an!
Bikefitting
Über Nutzen und Zweck eines Bikefittings brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr zu reden - zumindest ich persönlich halte ein Fitting jedenfalls für angebracht, wenn man sich ein neues Rad zulegt oder gröbere Änderungen am bestehenden durchführt.
Während das Bikefitting - egal ob statisch oder dynamisch - die Position des Körpers am Rad festlegt bzw. gewisse Einstellungen empfiehlt, sagt die richtige Position des Sattels noch nichts darüber aus, wie sich dieser anfühlt. Mit dem Bikefitting ist aber der Sattel an der richtigen Position - immerhin schon etwas.
Als nächste geht man in der Regel an die Messung des Sitzknochenabstands, um die Breite eines möglichen Sattelmodells zu eruieren. Die Messung geht schnell, die Punkte und der Abstand dazwischen schnell vermessen und die Sattel-Hersteller bieten in der Regel unterschiedliche Modelle oder Varianten für den jeweliigen Sitzknochenabstand an. Damit ist man noch einmal einen Schritt weiter - der Sattel ist an der richtigen Position und das Modell ist grundsätzlich einmal nicht so falsch.
Mit der Satteldruckanalyse kommt noch eine weitere Ebene im Rahmen des Fittings dazu - die Druckverteilung am Sattel. Nehmen wir meinen Sattel und meinen Hintern: Mein Sitzknochenabstand beträgt gute acht Zentimeter, der dazu passende Sattel würde mich allerdings nur bedingt glücklich machen. Die Satteldruckanalyse zeigt, dass ich - in gefitteter Position - auf dem vorderen Teil des Sattel sitze, und zwar egal ob in Unter- oder Oberlenkerposition. Die Druckverteilung zeigt dementsprechend, dass ein Großteil des Drucks vor meinen Sitzknochen auf den Sattel kommt. Sich nur am Sitzknochenabstand zu orientieren , wäre in meinem Fall also irreführend - schließlich müssen meine Sitzknochen nur einen Bruchteil der eintretenden Energie ableiten.
Jetzt sind mein Equipment und mein Körper großteils ein eingespieltes Team, so dass ich - glücklicherweise - ohne große Probleme oder Notwendigkeiten ganz gut mit meinem vorhandenen Sattel unterwegs bin. Die Satteldruckanalyse hat in meinem Fall gezeigt, dass mein System gut funktioniert, dennoch sind auch hier noch Optimierungen möglich. “Optimierungen” haben nun oft schon den etwas fahlen Beigeschmack von Über-Performance, unnötigen Investitionen und Verschlimmbesserungen. Im Fall der Satteldruckanalyse ist das jedoch anders, geht es doch im weiteren Sinne auch um Komfort und Wohlfühlen und damit um den Spaß am Radeln. Das ist für mich besser und einfacher argumentierbar als die Suche nach 0,5 zusätzlichen Watt irgendwo im Antriebsstrang.
Um die Sinnhaftigkeit der Satteldruckanalyse zu verdeutlichen, habe ich als Kontrast den neuen Fizik Vento Argo auf mein Rad geschraubt. Dieser ist im Wesentlichen kurz und hinten breit, damit soll der Fahrer oder die Fahrerin zu einer aerodynamischen Position am rad “animiert” werden. Man kann mit dem Becken weiter nach vorne rutschen und trotzdem verteilt sich der Druck besser (weil vorne breiter). Ich hatte den Sattel bereits testweise für zwei Ausfahrten draußen auf dem Rad. Bei Einheiten auf dem Kickr traten bei mir aber fast schon Schmerzen auf, so unangenehm war die Sitzposition, wenn das Rad statisch in der Rolle eingespannt ist. Die Satteldruckanalyse mit dem Vento bestätigt in Farbe und Bewegung, was meine interne Sensorik schon gespürt hat - rote Punkte, ungleiche Verteilung, Wechsel der Position und Ausweichbewegungen auf der Suche nach einer schmerz- und druckfreien Sitzpoition. Dass ein derartiges Herumrutschen im Sattel, Ausweichen und Abfedern mit dem ganzen Körpern auch zu entsprechenden Leistungseinbußen führt, ist selbstverständlich.
Auch Jojo hat den Fizik Vento ausprobiert
Es macht also durchaus Sinn, die Satteldruckanalyse als Teil des “Bikefittings” zu sehen, geht es doch um ein Gesamtsystem, das mit diesem Tool um eine weitere, wichtige Ebene angereichert werden kann.
Sattelkauf
Wer kein Bikefitting braucht, sondern “nur” auf der Suche nach einem Sattel ist, kann auch von der Satteldruckanalyse profitieren. Das “nur” steht deshalb unter Anführungszeichen, weil die Suche nach dem richtigen Sattel für manche eine eigene Mammutaufgabe darstellt. Vielleicht ist das auch ein Indikator dafür, dass die Vermessung der Sitzknochen alleine eben noch nicht ausreichend ist - zumindest nicht immer.
Wenn man schon unzählige Sattel-Modelle durchprobiert hat, sich aber bei keinem der notwendige Wohlfühlfaktor einstellt, kann eine Satteldruckanalyse vermutlich die fehlenden Puzzlesteine und Informationsschnipsel liefern, um jenes Modell zu finden, das zum individuellen Hinterteil passt.
Aber auch wer zum ersten Mal in einen Sattel investieren möchte oder einfach einen neuen haben will, kann mit der Analyse eine zusätzliche Entscheidungshilfe heranziehen. In meinen Augen jedenfalls besser als beispielsweise der Sattel-Finder von (den von mir ansonsten sehr hochgeschätzen Herrschaften von) Fizik, bei dem man mehr oder weniger eingibt, für wie gelenkig man sich selbst hält, und dann spuckt das System den empfohlenen Sattel aus - aus meiner Sicht ungenügend und suboptimal, schließlich kostet so ein Sattel auch schon mal seine 150 oder 200 Euro…
Schmerzen
Im Worst Case kommt man mit Schmerzen oder Problemen zur Satteldruckanalyse. Dabei kann der Hintern selbst das Problem sein - wenn dort durch Druck Verletzungen oder Problemzonen entstehen -, oder aber es treten Schmerzen an anderen Stellen auf. Der Körper am Rad ist ein Gesamtsystem aus Einzelteilen, Winkeln und Verteilungen - sobald bei einer Komponente ein Problem auftritt, wirkt sich das auf das Gesamtsystem aus. Schmerzen können daher auch in Körperteilen auftreten, die von der eigentlichen Problemzone weit entfernt liegen.
Hier helfen wiederum die bunten Farbsegmente und die dazugehörigen Datenfelder der Satteldruckanalyse weiter, geben diese doch Auskunft über die Druckverteilung und eventuelle Druckspitzen. Nicht alle Probleme werden auf die Sitzposition und die Position am Sattel zurückzuführen sein, aber mit Hilfe der Satteldruckanalyse kann man zumindest einige dieser Quellen ausschließen. Schließlich wollen wir alle ohne Schmerzen am Rad sitzen!
So - wie bei mir auf dem Fizik - sollte es nicht aussehen… Rot und schief!
und meine anderen Räder?
Mein persönliches Resüme der Satteldruckanalyse ist ein sehr positives. Ich habe das Glück eines bereits gut funktionierenden Setups, das ich weiter verbessern kann. Ich werde - auf Basis der Empfehlung von Christoph - den Brooks Cambium C13 mit geschlossener Satteldecke auf mein Rad schrauben (mehr dazu in Kürze). Dieser führt meine Gewohnheiten weiter, bietet aber eine bessere Druckverteilung für meine individuellen Bedürfnisse.
Für meine Pläne und Herausforderungen des Jahres 2020 - räusper… Race Around Austria Challenge… - ist eine gute Sitzposition und ein funktionierendes System “Hintern-Sattel” essentiell. Auch das beste und meiste Training wird wirkungslos verpuffen, wenn nach drei oder vier Stunden das Sitzen schwerfällt. Vor dem Sommer werde ich auch noch einmal ein weiteres Bikefitting einplanen. Auch die Position und die körperlichen Rahmenbedingungen verändern sich laufend - da kann man ruhig auch zwischendurch einmal nachkontrollieren, ob noch alles passt.
Ein absolutes Luxusproblem bringt Christoph dagegen nur zum Schmunzeln. Ist man in der Situation, mit mehreren Rädern unterwegs zu sein, sind dort in der Regel auch unterschiedliche Sättel montiert. Eine Satteldruckanalyse spuckt mitunter eine Empfehlung für einen spezifischen Sattel aus, allerdings heißt das nicht automatisch, dass dieser Sattel auch auf (allen) anderen Rädern gleich gut passen wird. Gleichzeitig wäre es allerdings übertrieben, mit allen Rädern eine neue Vermessung und Druckanalyse zu machen. Die Empfehlungen der Satteldruckanalyse und der darauf aufsetzenden Analyse von Christoph geben gute Hinweise darauf, wonach man beim Sattelkauf Ausschau halten sollte.
Aktion bei PBike
Während ich bei PBike Versuchskaninchen spielen durfte, kommen auch alle anderen in den Genuss einer Einführungsaktion. Dabei gibt es die Satteldruckanalyse um einen speziellen Einführungspreis von 59 Euro. Einfach bei PBike anrufen oder vorbeischauen und Termin ausmachen.
Helm mit Ablaufdatum
Es muss 2017 oder 18 gewesen sein, als ich in Osttirol einmal von einer Ausfahrt zurück zum Haus meiner Schwiegereltern gekommen, voller Elan auf die Garage zugegangen bin und dabei die Höhe unter- (oder besser gesagt die nicht vorhandene “Clearance”) des Garagentors unterschätzt habe. Es machte einen gröberen Knall und mein Helm hatte eine tiefe Macke vom Garagentor. Klein genug zwar, dass man den Helm nicht auf den ersten Blick entsorgen müsste aber doch so groß, dass man darüber nachdenkt, wie es weitergeht. Und dabei war mir der Look meines POC Octal viel wert, sah ich im Spiegel doch immer aus wie einer dieser Super-Pilze aus Super Mario!
Ablaufdatum!
Seitens Helm-Industrie wird geschlossen darauf hingewiesen, dass ein Helm nach einem Sturz ausgetauscht werden soll. Ebenso besitzt ein Helm jedoch ein Ablaufdatum, nach diesem - auch ohne Zwischenfall - ein Austausch ansteht. Wühlt man sich durch die Homepages der Hersteller und Beipackzettel erhält man ein doch überraschend einheitliches Bild:
Die hier aufgelisteten Hersteller empfehlen, einen Helm nach 3 bis 5 Jahren auszutauschen. Wichtig ist dabei allerdings, dass dieser Zeitraum erst mit der Nutzung des Helms beginnt. Damit sind Lagerungen beim Hersteller, bei Zwischenhändlern und in Shops nicht relevant. Die Uhr beginnt erst zu ticken, wenn der Helm ausgepackt, aufgesetzt und eingesetzt wird. Dann ist er nämlich der Witterung ausgesetzt, Temperaturschwankungen, Schweiß, UV-Strahlung, Vibrationen und Erschütterungen. Diese Faktoren werden ab diesem Zeitpunkt an der Lebensdauer des Helms knabbern und sukzessive dessen Schutzwirkung reduzieren.
Degradation
Ich bin in der Materialkunde nicht genug bewandert, um den Unterschied zwischen EPS und Styropor zu benennen. Faktum ist, dass dieses sogenannte “expandierte Polystyrol” (kurz EPS) dazu da ist, unseren Kopf bei einem Aufprall zu schützen. EPS dämpft einen Schlag ab und verteilt die dabei auftretende Energie auf eine möglichst große Fläche, dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Kopfverletzungen. Zusatzsysteme wie MIPS oder SPIN ändern an dieser Grundfunktion im wesentlichen nichts, es handelt sich dabei vielmehr um ergänzende Features, die mehr Schutz bei schrägen Einschlägen bieten sollen. Wir erinnern uns an die Sendung mit der Maus: Da ist die Melone im Fahrradhelm immer senkrecht von oben heruntergefallen. Die Realität hält sich - sofern dieser Fall überhaupt eintritt, wir hoffen es nicht! - selten an derartige Regeln, daher machen ergänzende Schutzfunktionen in meinen Augen durchaus Sinn.
EPS hat aber leider auch die Eigenschaft, nicht UV-stabil zu sein und bei Lichteinwirkung langsam aber doch zu verspröden. Aus diesem Grund haben alle Helme eine Kunststoffschicht, die über der eigentlichen EPS-Lage angebracht ist. Aber auch von innen - und dort gibt es keinen Schutz für das arme EPS außer ein paar gepolsterten Riemen - setzen wir beispielsweise mit unserem Schweiß dem Material zu. So oder so ist das Ergebnis, dass sprödes und unelastisch gewordenes EPS seine Dämpfungseigenschaften einbüßt und damit unserem Kopf bei Stürzen nicht mehr den vollen Schutz bieten kann.
Schäden durch UV-Licht sind mit freiem Auge unmöglich zu erkennen, dementsprechend ist es schwer, eine Aussage darüber zu treffen, wie sehr der eigene Helm eventuell schon in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Tipp der Hersteller ist die Lagerung des Helms in einem Stoffbeutel, der oft sogar mit dem Helm mitgeliefert wird. Mea maximal culpa - ich habe die Stoffbeutel meiner Helme noch nie verwendet.
Bei der Recherche für diesen Blogbeitrag bin ich ab und zu auch über Fälle gestoßen, in denen Schnallen und Riemen Probleme verursacht haben. Defekte Schnallen, nicht (mehr) funktionierende Schließsysteme am Kinnriemen oder Schäden am Innenleben der Helme (den Verstell-Riemen) können natürlich auch im Laufe der Zeit auftreten, allerdings hatte ich persönlich noch keine derartigen Probleme und kenne auch keine aus meinem Freundeskreis. Aber auch hier gilt: etwas Pflege und eine regelmäßige Kontrolle der Funktionen und Bestandteile sorgt üblicherweise für eine etwas längere Lebensdauer der Komponenten.
Sturz
Im Gegensatz dazu ist ein Helm sofort auszutauschen, wenn man damit gestürzt ist. Sind Teile des Helms zerbrochen, bei tiefen Rissen oder wenn die strukturelle Integrität des Helms in irgendeiner Art und Weise nicht mehr gewährleistet ist, muss ein neuer her. Schwieriger wird es allerdings, wenn die Schäden nicht ganz so offensichtlich sind. Laut Herstellern ist der Helm auch zu tauschen, wenn nur ein kleinerer Sturz passiert ist oder aber auch wenn dieser von der Garderobe auf den Fliesenboden heruntergefallen ist. In solchen Fällen sind die Schäden oft nicht erkennbar aber Mikrorisse im EPS können die Stabilität des Gesamtsystems beeinträchtigen. Ich verstehe den Aufschrei, gut 100-200 Euro “in den Wind zu schießen”, nur weil der Helm einmal auf den Boden gefallen ist. Und letztlich bleibt es auch eine individuelle Entscheidung, den Helm auszutauschen oder weiter zu benützen. Manch eine*r mag eine gefinkelte (und aufgrund der Einhelligkeit der Angaben auch konzertierte) Aktion der Helmindustrie sehen, andere eine Übervorsichtigkeit oder Überbehütung. Ich für meinen Teil habe beschlossen - glücklicherweise ohne dafür einen Anlassfall zu brauchen - dass mir mein Leben und meine Gesundheit dieses Geld wert sind.
Zersägen!
Dennoch wollte ich den Dingen noch etwas weiter auf den Grund gehen und in meinen Helm “hineinschauen”. Das Gerede von Mikrorissen, unsichtbaren Schäden und Materialermüdung, die man nicht erkennen kann, ist für einen grundsätzlich neugierigen Menschen wie mich unbefriedigend. Den eingangs erwähnten POC Octal habe ich nach dem Garagentor-Kontakt damals nicht weggeworfen - ein perfektes Anschauungsobjekt also für einen Helm, den man eigentlich entsorgen müsste. Und nachdem der neue und schicke POC Omne Air wundersamerweise auf die Garderobenseite meiner Freundin gewandert ist, konnte ich auch ihren alten Stadthelm als Versuchsobjekt heranziehen.
Zwei Helme also - einer beschädigt und einer über die Empfehlung des Herstellers hinaus alt -, denen ich mit der Säge zuleibegerückt bin. Die laue Nachmittagsstimmung wird von einer kreischenden und schreienden Geräuschkulisse zerschnitten, es schmerzt in den Ohren als sich das Sägeblatt langsam durch die obere Kunststoffabdeckung arbeitet. Während das EPS nachher ein Klacks für die Säge sein wird, stellt die obere Schicht ein tatsächliches Hindernis dar - hier hätte ich weniger Widerstand erwartet.
Ich nehme bei beiden Helmen die Mitte ins Visier, beim POC möchte ich mit der Säge außerdem jene Stelle erwischen, die ich damals am Garagentor etwas eingedellt habe. Es gilt herauszufinden, ob das Material dort irgendwie anders aussieht als an den unbeschädigten Stellen. Durch das EPS flitzt die Säge nur so durch, beim POC aufgrund der zahlreichen Belüftungsschlitze noch etwas schneller. Am Ende liegen zwei Helme in jeweils zwei Teilen vor mir. Der Gedanke, dass so ein Szenario nicht mutwillig durch eine Säge, sondern auf anderem Wege herbeigeführt werden könnte, ist wenig erbaulich und verschwindet schnell wieder im Hintergrund.
Auf den ersten Blick sind die Erkenntnisse meiner Säge-Aktion enttäuschend. Weder sind - rein optisch - große Unterschiede zwischen dem 60 Euro Stadthelm und dem 240 Euro Rennradhelm erkennbar, noch sichtbare Beeinträchtigungen an der eingedellten Stelle des POC. Auch finde ich keinerlei Hinweise auf mögliche Alterungserscheinungen des in die Jahre gekommenen Stadhelms. Bei näherer Betrachtung erkennt man minimale und feine Unterschiede in der Struktur des EPS, manche der einzelnen “Punkte” oder Zellen liegen hier näher beisammen oder wirken etwas komprimierter, da wo der Schaden aufgetreten ist. Ich versuche noch, mit allerlei Werkzeug und Einwirkung den einen oder anderen Effekt herbeizuführen oder eine Reaktion des Materials zu verursachen, aber es tut sich nicht allzu viel. Auch zerschnitten haben das Material und die restliche Konstruktion noch eine erstaunliche Stabilität und Härte.
Gut, ich bin nicht der TÜV, ein Messlabor oder eine andere geeichte, genormte und wissenschaftlich akkredierte Stelle. Ich kann mich gut und gerne damit zufriedengeben, dass ich aus diesem Versuch keine großartigen Erkenntnise gewonnen habe. Die Spannung, den Helm zu zerschneiden und die Freude am Experiment waren trotzdem da. Ich vertraue auf die Erkenntnisse der Hersteller und das Know-How der Materialwissenschafter und konzentriere mich auf das, was mir mehr Spaß macht - das Radfahren.
Epilog
Drei Dinge bleiben noch zu erwähnen, bevor wir uns wieder auf den Sattel schwingen und die Helme in der freien Wildbahn ausführen.
Modifikationen
Es klingt immer etwas oberlehrerhaft und ist einer jener Teile, die man in Gebrauchsanweisungen immer besonders gerne und schnell überblättert: Modifikationen am Helm führen grundsätzlich und so gut wie immer zu einem Verlust der Garantieleistung aber auch zu einer potentiellen Minderung der Schutzwirkung. Sachen auszuschneiden, umzubauen, auszuhöhlen, zu verschlimmbessern oder irgendwie anders zu verändern, ist in den meisten Fällen keine allzu gute Idee.
Etwas weniger “dringlich” ist der Hinweis, möglichst auf Aufkleber und dergeichen zu verzichten. Diese haften aufgrund des darin enthaltenen Klebstoffes, dieser kann natürlich die Oberflächen und Materialen des Helms entsprechend beeinträchtigen. Ausnahme sind Pro-Tour-Teams - die verwenden ihre Helme in der Regel aber auch nicht 3-5 Jahre.
Bleibt die Frage der montierten Action-Cams. Bei einem Sturz können diese schwere Verletzungen verursachen oder verstärken, da an jenen Stellen nicht der stoßmindernde EPS-Schaum sondern ein spitzer oder zumindest klobiger Gegenstand den Kontaktpunkt bildet. Am Rennrad sieht man Action-Cams aber ohnehin nicht so oft - erstens kostet der zusätzliche Luftwiderstand mindestens 2,39 Watt, zum anderen hält sich am Renner auch oft die aufzuzeichnende “Action” in Grenzen. (OK, ich halte mich hier auch nicht immer daran, bevorzuge aber die Freihand-GoPro-Haltung oder den Brustgurt).
Kennzeichnung
Um das Produktionsdatum eines Helmes zu finden, sucht man üblicherweise auf der Innenseite des Helms die diversen Aufkleber ab, bis man - neben Zertifikaten, Hinweisen, Firmenlogos und Gütesiegeln - auf das gesuchte Datum stößt. Bei teureren Modellen sind daneben üblicherwese noch Helmtyp, Größe und Gewicht vermerkt. Ein Blick auf die Homepage des Herstellers ist auch nie falsch.
Entsorgung
Ein spannender Punkt, zu dem ich im Zuge meiner Recherchen nur Probleme aber keine Lösungen gefunden habe, ist die Entsorgung alter Helme. Bei einem theoretischen Austausch aller Helme alle drei Jahre, kommen erkleckliche Mengen an Material zusammen und im Moment landen diese im Restmüll.
Recyclingmethoden gibt es zwar grundsätzlich, ebenso eine Hand voll Unternehmen, die derartige Prozesse grundsätzlich übernehmen würden. Allerdings steht der Nutzen des Recyclings des EPS-Materials (noch) in keiner Relation zum Aufwand, der angesichts der vergleichsweise geringen Menge an Material entsprechend hoch ist.
Am Lebenszyklus der Produkte kann man nur bedingt schrauben - wenn ein Helm ausgetauscht gehört, muss er ausgetauscht werden. Vielleicht finden die Hersteller gemeinsam Lösungen, die hier bessere Antworten geben können!
Bekleidung in der kalten Jahreszeit
Wie jedes Jahr möchte auch diesmal wieder mein persönliches Best-Of an Winterkleidung mit euch teilen. Von mir getestet, ausgeführt und begutachtet, wie immer völlig subjektiv! Und um auch diesen Punkt gleich vorwegzunehmen: Ja, einige der hier genannten Produkte habe ich über Kooperationen zur Verfügung gestellt bekommen - wenn sie allerdings ihren Zweck nicht gut erfüllen würden, wären sie weder Teil meiner Garderobe noch dieses Blogposts.
Fingerscrossed Merino Socken
Ich persönlich hab es ja gerne warm. Sobald mir kalt wird - und mit „kalt“ meine ich, dass auch nur ein Quadratzentimeter meiner Körperoberfläche unangenehme Kälte über einen längeren Zeitraum erleidet - dann werde ich unrund und habe nur noch begrenzt Spaß am Radeln. Überhitzung hingegen ist in meiner Welt nur ein selten auftretendes Phänomen, dazu fahre ich im Winter offenbar zu wenig intensiv - verausgaben kann man sich da besser bei Einheiten auf Zwift. Kopf, Finger und Zehen sind an der frischen Winterluft nicht nur bei mir die empfindlichsten Körperstellen, wie ich bei einer kurzen Blitzumfrage in meinem Freundeskreis feststellen konnte. Diesen Teilen daher wohlige Wärme zukommen zu lassen, bürgt für lang anhaltenden Spaß im Sattel.
Für untenrum schwöre ich auf Merino-Socken. Merinowolle ist schon lange kein Geheimtipp mehr - für Wolle vergleichsweise flauschig und weich, tolle Klima-Eigenschaften und weitgehende Geruchsneutralität! Punkt. Je höher der Merino-Anteil, desto besser - vor allem die Geruchs-Neutralität steht und fällt mit diesem Umstand. Fingerscrossed ist an sich eher für bunte und gemusterte Socken bekannt, sehr diskret kommen dagegen die Deep Winter Merino Socken daher - schwarz nämlich. Sogar die obligatorische Niete am linken oberen Sockenrand ist dezent angegraut. In der extrawarmen Version sind die Bereiche von Zehen über Sohle bis über die Ferse noch mit zusätzlich flauschigem Material versehen, dadurch bleiben sogar meine Füße im Winter schön warm. Die Frage, ob Socken nun über oder unter der Hose getragen werden, möchte ich hier nicht weiter erörtern - da könnte ich ja genauso gut eine Diskussion eröffnen, ob Canon oder Nikon besser ist oder iOS oder Android oder Beatles oder Stones... (Canon, iOS und Stones, falls es wen interessiert!)
Thermopad Zehenwärmer
Wir bleiben bei den Füßen und senken die Temperatur noch um ein paar Grad. Dann lege ich üblicherweise noch ein Scheibchen oben drauf und gönne mir einen Satz Wärmepads in meinen Schuhen. Ich habe vor zwei Jahren einen Artikel dazu auf Bikeboard.at gelesen, dann gleich die Zehenwärmer von Thermopad bestellt und sie seitdem nicht mehr losgelassen. Es handelt sich um Einwegprodukte, die Pads geben laut Hersteller bis zu 8 Stunden Wärme ab. Ob diese Dauer auch eingehalten werden kann, habe ich nicht überprüft, da wird mir vorher irgendwo anders so kalt, dass ich wieder nach Hause fahre. Aber bei meinen Ausfahrten über 3-4 Stunden funktionieren die Pads jedenfalls einwandfrei. Die Aktivkohle in den Pads wird durch Sauerstoff aktiviert, das heißt man packt die Wärmer kurz vor dem Fahren aus, lässt sie ein paar Minuten liegen und klebt sie dann auf die Zehen oder Füße. Wichtig ist, die Pads vordem Anbringen lange genug „atmen“ zu lassen - ich packe die Pads einfach aus, bevor ich mich anziehe. Ankleiden im Winter ist sowieso eine Prozedur, die ein paar Minuten dauert, bis dahin haben sich auch die Pads schön aufgeheizt. Klebt man die Pads direkt aus der Packung auf und schlüpft in den Schuh, dann kommt nicht mehr ausreichend Luft zu den Pads und diese werden nicht richtig warm. Entgegen der gängigen Anwendung und auch den Bildern auf der Homepage des Herstellers und der Verpackung, klebe ich die Pads oben auf meine Zehen bzw. meinen Vorfuß anstatt unten. Die Wärmeentfaltung funktioniert dort genauso gut, allerdings erspart man sich den „Knubbel“ unter den Zehen. Das Pad trägt schon ein paar Millimeter auf und zumindest bei mir war es so, dass ich ein unten angeklebtes Pad beim Treten bemerke. Thermopad hat außer den Zehenwärmern auch noch alle möglichen anderen Wärmer im Sortiment (von Hand über Rücken bis hin zur ganzen Fußsohle), diese habe ich allerdings nicht ausprobiert - mir reichen die warmen Zehen :)
Fizik Artica R5
Eine vermeintliche Glaubensfrage betrifft hingegen die Wahl zwischen Überschuhen und Winterschuhen. Es gibt für beide Varianten unterschiedliche Pros und Cons. Ich persönlich habe mich vor 2 Jahren am MTB für Winterschuhe entschieden, letztes Jahr dann auch am Rennrad. Überschuhe habe ich mir trotzdem behalten, aber eher für den Notfall in wärmeren Phasen des Jahres oder als Backup am Berg. Ich sehe den Vorteil der Winterschuhe in der einfacheren Handhabung: Anziehen, fertig! Wie schon oben erwähnt, wird das Anziehen im Winter ohnehin schon oft genug zur Tortur - meist ist man schon kräftig verschwitzt, bevor man überhaupt noch bei der Haustür draußen ist. In meine Winterschuhe schlüpfe ich hinein und fertig.
Da ich auf großem Fuß lebe, besteht für mich ein weiterer Vorteil darin, dass Winterschuhe weniger dick auftragen als dicke Socken, Winterschuhe plus Überschuhe. Das habe ich zum ersten Mal gemerkt, als ich bei unterschiedlichen Rädern mit dem Fuß an der Kettenstrebe angekommen bin, weil durch Schuh + Überschuh einfach zu viel Material da war.
Dabei hatte meine Beziehung zu Winterschuhen einen durchwachsenen Start. Meine ersten MTB-Winterschuhe von Mavic konnten sich dadurch „auszeichnen“, dass sie unten bei den Cleats ungefiltert und recht direkt die kalte Winterluft hereinließen und damit das Prinzip Winterschuh ad absurdum führten. Auch eine (nur optional erhältliche) dickere Einlegesohle konnte das System nicht retten. Die Mavic-Winterschuhe fürs Rennrad hingegen (das Nachfolgemodell) waren in diesen Belangen besser, auch wenn mir dort noch immer zu viel Luft von unten reingekommen ist. Gore Tex und Dichtheit an der Oberseite sind eben nur die halbe Miete, wenn von unten Wasser und Kälte eindringen können. Glücklich bin ich erst, seit ich bei Winterschuhen zu Fizik gewechselt bin - ich glaube der Name des Modells „Artica“ hat die Eiskönigin in mir angesprochen...
Auch wenn die „Schnürung“ des Fizik (sie ist eher ein Zugsystem) auf den ersten Blick etwas irritiert, der Fuß hat im Schuh einen sehr guten Halt. Die Isolierung ist einwandfrei, eine wasserdichte Außenhaut mit Reißverschluss besorgt den Rest. Und - oh Wunder! - von unten kommt keine Kälte an die Fußsohle, auch mit der mitgelieferten Innensohle. Das Profil an der Sohle ist ausreichend, um auch im Winter voranzukommen, wenn man einmal neben dem Rad steht und nicht darauf sitzt - wobei man auch hier, wie bei allen Radschuhen, keinen Sonderpreis für Anmut und Eleganz gewinnen wird. Bei Mountainbike-Schuhen und gleichzeitig Verwendung von Crankbrothers oder Shimano-Cleats ist mir aufgefallen, dass man aufgrund des recht hohen Profils jedenfalls die mitgelieferten Spacer unter die Cleats schrauben sollte, damit man leichter ein- und ausklicken kann. Darunter leider allerdings wiederum das angenehme Gehen in den Schuhen, weil die Cleats leicht über das Profil der Sohle überstehen - Vorsicht auf glatten Böden!
Wenn wir schon kurz über Crankbrothers reden, ich habe meine Shimano SPDs gegen Crankbrothers Eggbeater Pedale getauscht, was gerade auch im Winter und bei Schnee & Matsch von Vorteil ist. Zum einen sind die minimal schlankeren Cleats etwas weniger schmutzanziehend, vor allem aber ist der Einstieg in die Pedale leichter, da man von vier Seiten einklicken kann - da kann man fast nicht danebenhauen!
Löffler Bike ISO-Jacke Primaloft Mix
Genug von den Füßen gesprochen, kommen wir zum Oberkörper. Auch hier habe ich in den vergangenen Jahren schon einiges ausprobiert. Das Zwiebelprinzip habe ich dabei immer angewendet, weil es am praktischsten ist und die größte Flexibilität bietet. Allerdings habe ich die Kombinationen variiert - dick über dünn, dünn über dick, Jacke direkt über Baselayer, usw. Ich werde hier auch weiterhin Dinge ausprobieren und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich einen neuen „optimalen“ Zustand herausfinde - momentan ist aber meine Lösung für kalte Tage ein Merino Baselayer, darüber ein (eher dünnes) Langarmtrikot und außen noch eine Jacke. Die Jacke ist für die Hauptfunktion des Wetterschutzes zuständig, mit unterschiedlichen Modellen und Funktionalitäten kann man sich hier den tatsächlichen Wetterbedingungen anpassen - dünne Regenjacke, dichte Outer-Shell, gefütterte Primaloft-Jacke.
Besonders in Herz geschlossen, - wie erinnern uns an meine oben bereits erwähnte Wärme-Bedürftigkeit - habe ich Primaloft-Jacken, weil diese eine zusätzlich Isolation und damit Kuscheligkeit bieten. Für intensive Fahrten mögen diese Jacken dem einen oder der anderen zu warm und dick sein, für mich allerdings passt das in der Regel sehr gut. Es muss natürlich auch nicht „Primaloft“ sein, hierbei handelt es sich ja nur um ein Patent - andere Marken nennen ihre Technologien anders, die Funktion ist aber meistens eine ähnliche. Vorteil gegenüber der klassischen Daune ist, dass Primaloft auch bei Nässe noch funktioniert, nicht so verklumpt wie Daune und auch entsprechend schneller trocknet. Dass Primaloft-Fasern mittlerweile zu einem großen Teil aus recycelten Plastikflaschen erzeugt werden, passt außerdem auch ganz gut ins derzeitige Bild.
Auch unter dem Lichte der Nachhaltigkeit steht mein Plan, dort wo es möglich ist, auch regionale und lokale Produkte einzusetzen oder zumindest ausfindig zu machen - in Zeiten der Globalisierung ist das ja mitunter nicht so einfach. Bei Radbekleidung stößt man dabei in Österreich sehr schnell auf Löffler, einem Unternehmen, dass seinen Hauptsitz und seine Produktion im oberösterreichischen Ried im Innkreis hat. Während dazu noch ein gesonderter Blogpost in der Serie „Made in Austria“ folgen wird, soll es hier um die Primaloft-Jacke von Löffler gehen, die sämtliche kalten Temperaturen gekonnt vom Oberkörper fernhält. Dafür im Einsatz ist die „Primaloft Gold“-Faser, die die technologische Speerspitze von Primaloft darstellt und dementsprechend den höchsten Qualitätsstandard für sich beansprucht. Im Design ist die Jacke eher klassisch gehalten und in mehreren Farben erhältlich, wobei wenn schon Winter, dann in Signalfarbe! In grellem Gelb fällt es schwer, im Grau und Weiß des Herbsts und Winters übersehen zu werden - ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn man auch in der dunklen Jahreszeit sicher vorankommen möchte. Besonders gut gefallen mir die Abschlüsse an Armen und Hals, diese sind breit und gut verarbeitet, bieten dementsprechend sowohl Komfort als auch Schutz vor den Elementen - hatte ich in der Form noch bei keinem anderen Produkt! Die Tasche an der Brust ist praktisch, zum Beispiel für das Handy, wenn man seine winterlichen Heldentaten für Instagram festhalten möchte. ;) Sonst kann man dort kälteempfindliche oder wertvolle Dinge verstauen. Am Rücken befindet sich eine große Tasche in der Mitte, diese dient gleichzeitig als Tasche für die Jacke selbst - wird diese nicht gebraucht, kann man sie einfach „in sich selbst“ hineinstopfen und per Reißverschluss zumachen. Die Jacke ist recht weit nach unten gezogen, wenn man ansonsten eher Aero-Schnitt gewöhnt ist - bei kalten Temperaturen aber jedenfalls von Vorteil. Trotz allem ist der Schnitt sportlich, nichts ist im Weg, nichts flattert.
Weil schöne Fotos von anderen besser sind, als verwackelte Selfies: Hier Oliver in der Löffler-Jacke während der Nacht auf unserer Race Around Austria-Testfahrt rund um Oberösterreich. (Er trägt hier noch ein reflektierendes Gilet drüber!)
Noch einmal Oliver bei der RAA-Testfahrt bei knackigen Morgen-Temperaturen am Ziehberg.
Isadore Ovada Deep Winter Baselayer
Unter der Jacke ist je nach Wetter Spielraum für unterschiedliche Lösungen. Fixstarter in meinem Setup ist jedoch der Merino Baselayer von Isadore, der sich im letzten Winter bereits einen Platz in meinem Herzen erarbeitet hat. Weiches Merino, ein hoher Kragen und ein isolierter Brustbereich sind die Zutaten, die dieses Kleidungsstück für mich zum essentiellen Begleiter machen. Der Schweiß wird gut verarbeitet, der Baselayer wird nie so durchnässt sein, dass man klimatisch in eine Notlage gerät. Das Material fühlt sich auf der Haut gut an - egal ob trocken oder nass - und trocknet Merino-entsprechend schnell. Die Isolierung im Brustbereich bietet zusätzlichen Schutz, falls der Wind doch einmal irgendwo einen Weg durch die Außenschicht finden sollte. Mit dem hohen Kragen erspart man sich hingegen in vielen Fällen (bei gemäßigten Temperaturen) einen extra Buff für den Hals oder ein Halstuch. Das finde ich persönlich wieder gut, weil ich nicht gerne mit einem dicken Wulst um den Hals unterwegs bin und mich dabei irgendwie immer in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühle. An den Ärmel-Enden sind noch Schlaufen für die Daumen angebracht, damit auch ja nichts verrutschen kann. Ich verwende diese allerdings (auch bei anderen Kleidungsstücken) nicht bzw. kann ich diese nicht gescheit verwenden, weil meine Arme dafür irgendwie zu lange sind - große Menschen, unklare Proportionen...
Das ist übrigens der zweitwärmste/zweitbeste Merino Baselayer von Isadore ;)
Zum Abschluss - und das ist nichts Neues, weil schon bei mehreren Gelegenheiten vorgebracht - möchte ich noch mein persönliches „last resort“, mein letztes Mittel gegen die Kälte erwähnen: Coldcream! Wer sich schon einmal bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in eine längere Abfahrt begeben hat oder bei eisigem Wind unterwegs war, kennt das Gefühl, wenn die Haut auf den Wangen zu spannen beginnt und die Kälte auf der Stirn sich bis in den Kopf hinein bohrt. Etwas Kältecreme vor dem Wegfahren strategisch gut platziert auftragen, und die Welt schaut schon wieder anders aus. Wichtig ist dabei, auf Produkte zu verzichten, die auf Wasser basieren (Wasser... Minusgrade...Hm?). Wer dennoch nicht auf reine Erdölerzeugnisse setzen will (und das wäre die naheliegende Alternative), ist bei Weleda ganz gut bedient, da ist außerdem noch Honig drinnen, das pflegt und riecht gut!
Ich hoffe, die eine oder andere Ausführung kann dabei helfen, die richtige Ausrüstung und Motivation für den Winter zu finden. Es geht im Endeffekt auch nicht darum, jeden Tag draußen zu fahren - und das sagt einer, der den Großteil des Winters auf Zwift Island verbringt. Aber es sind diese einzelnen Ausfahrten im Winter und bei Kälte, die gut geplant und auch gut ausgerüstet angegangen werden wollen. Und es sind gleichzeitig die Ausfahrten, die im Nachhinein oft als besondere Erlebnisse in Erinnerung bleiben. „Kannst du dich noch erinnern? Damals als es so kalt war und wir trotzdem fahren gegangen sind, ...“
Links
Fingerscrossed Merino Deep Winter, 30,00 Euro, fingerscrossed.design
Thermopad Zehenwärmer, 1,20 - 1,79 Euro (je nach Anzahl), www.thermopad.de
Fizik Artica R5, 200,00 Euro, www.fizik.com
Löffler Bike ISO-Jacke Primaloft Mix, 199,99 Euro, www.loeffler.at
Isadore Ovada Deep Winter Baselayer, 89,00 Euro, isadore.com
BMC Urs im Test
Nachdem ich im Sommer diesen Jahres philosophiert und endlich - für mich selbst und nach langem Überlegen - rausgefunden habe, was "Gravel" eigentlich bedeutet, welche Möglichkeiten damit verbunden sind und wohin die Reise gehen könnte, geht es nun um das Material an sich. Dass ich mit den Versuchen, meinen Crosser umzubauen gescheitert bin, lasse ich hinter mir. Vor mir liegen hingegen einige Ideen und Projekte, bei deren Realisierung ich mich gerne eines tatsächlichen Gravel-Bikes bedienen würde - wo nämlich weder Rennrad, Crosser noch MTB-Hardtail 100% hineinpassen. Die Rede ist von längeren Touren, Bikepacking und einem Vordringen in die Berge, ohne dabei größere Kompromisse eingehen zu müssen und gleichzeitig sowohl auf Asphalt als auch auf Schotter- und Waldwegen gleichsam gut vorwärts zu kommen.
Auf die Unterschiede zwischen den Radkategorien bin ich schon an anderer Stelle eingegangen, ebenso auf die Frage ob man unbedingt ein weiteres (spezifisches) Rad braucht (grundsätzlich Nein) oder ob man das nicht auch mit dem Crosser fahren könnte (grundsätzlich Ja). Belassen wir es dabei, dass Präferenzen und Vorlieben unterschiedlich sind, jede und jeder ohnehin für sich selbst entscheiden sollte, was sie oder er braucht und will. Am besten probiert man diese Dinge auch selbst aus, so wie ich das in Osttirol mit meinem Crossbike versucht habe und erst dort - im direkten Einsatz - draufgekommen bin, was ich "brauche" und welches Material dafür am besten geeignet ist.
Apropos selbst versuchen... Während meines Selbstversuchs im Sommer war das neue BMC Gravelbike gerade erst ein paar Wochen vorgestellt. Das Konzept war damals schon vielversprechend und ehrlicherweise hatte ich das Rad schon zu diesem Zeitpunkt ein bisschen in meinem Hinterkopf. Nun konnte ich „URS“ für einige Ausfahrten testen und dabei genau jene Punkte abklopfen, die ich auf meiner geistigen To-Do-Liste gespeichert hatte. Um das, was ich mir vorab zusammengesponnen hatte, zu verifizieren oder mich eines besseren belehren zu lassen.
URS
Urs ist zweifellos Schweizer, sein Name bezieht sich allerdings nicht auf den Bären (Ursus) sondern ist ein Buchstabenwort aus "Unrestricted" und damit der Verweis auf das "Anything goes" und die übergreifenden Disziplinen, die das Rad abdecken soll.
Was unterscheidet jetzt aber URS von den bisherigen - und von mir eher kritisch gesehenen - Gravelbikes, bei denen tendenziell nur breitere Reifen in einen bestehenden Rennradrahmen gehängt wurden?
Am wichtigsten ist wohl die spezielle Geometrie und diese spielt sich in erster Linie an der Front ab. Der Lenkwinkel ist sehr flach, um mehr Laufruhe und eine gute Basis im Gelände zu haben. Die dadurch entstehende Schwerfälligkeit in der Lenkung verhindert BMC durch einen kurzen Vorbau, der die entsprechende Reaktionsfähigkeit des Vorderrads sicherstellt. Im Großen und Ganzen kennt man das von modernen Mountainbike-Geometrien (nicht nur bei BMC), den eigentlichen Ursprung hat der Trend bei den Enduro-Bikes.
Der Rahmen ist eine Neu-Entwicklung und kein adaptierter Rennradrahmen. Die serienmäßig montierten 42mm WTB-Reifen belegen die enorme Reifenfreiheit. Wie auch einige andere Hersteller verbaut BMC ein Federungssystem am Hinterbau, um den Komfort im Sattel noch weiter zu erhöhen. Dabei kommt - wie auch schon bei den Teamelite MTB-Modellen von BMC - ein Elastomer-Element zum Einsatz, dass zwischen Sitzstreben und Sitzrohr unliebsame Schläge abfedern soll. Der Rahmen weist außerdem noch einige gravel- oder geländespezifische Merkmale auf, die das Leben einfacher und sicherer machen sollen: Protektoren für den Rahmen, zusätzliche Ösen und Schrauben für Taschen und Zubehör, eine Kabelführung in der Gabel für einen möglichen Nabendynamo und vieles mehr.
Je nach Ausstattungsvariante kommen noch weitere Goodies dazu: Carbon-Felgen fürs Gelände von DT-Swiss, offroad-spezifische Schaltgruppen, und und und. Ebenfalls abhängig von Modell und Ausstattung ist das Gewicht, das Topmodell fühlt sich mit seinen etwas über 8 Kilogramm beim ersten Mal Anheben erstaunlich leicht an, was natürlich auch der Performance während der Fahrt zugute kommt.
Die Varianten des URS
URS startet bei 2.999 Euro für das Modell "Four" und gipfelt mit 8.999 Euro bei URS "One".
Die Antriebe sind durchwegs als "1x" spezifiziert, je nach Gruppe bekommt man damit 11 oder 12 Gänge. Die Kompatibilität von Cross-, Rennrad und MTB-Gruppen ermöglicht es heutzutage ohne weiteres, einzelne Komponenten unterschiedlicher Gruppen zu kombinieren und dabei auch elektronische Schaltungen einzusetzen (beim URS One und Two). Bei der Übersetzung überrascht, dass nur das Topmodell eine größere Bandbreite bietet, 38x50 ermöglicht auch in steileren Gefilden noch eher ein Fortkommen als 40x42. Die Farben sind grundsätzlich Geschmackssache, gefallen - mir persönlich - aber in ihrer Schlichtheit sehr gut. Die Kontrastfarben an den Gabelholmen sorgen für etwas Abwechslung. Neben Rahmen und Gabel teilen sich auch alle Modelle die gleichen Reifen von WTB mit einer Breite von 42mm.
Meine Eindrücke - URS in Aktion!
Schon nach wenigen Metern merkt man, dass man sich nicht auf einem "verkleideten" Rennrad befindet. Nahe am Crosser aber dennoch anders in der Geometrie, der Straßenlage, Laufruhe und Charakteristik. Auch wenn man vermeintlich nicht geglaubt hat, dass zwischen Rennrad und Crosser noch Platz ist, der URS füllt hier definitiv eine Lücke. Und dass es sich dabei um keine rein marketing-kreierte Lücke handelt merkt man, wenn man mit URS ins Gelände abbiegt. Zugegebenermaßen sind es Feinheiten, aber je länger man im Sattel sitzt und je vielseitiger die Einsatzbereiche sind, umso mehr fallen diese Kleinigkeiten ins Gewicht.
Der Rahmen ist sehr steif und gibt gutes Feedback. Alleine schon der Blick auf den massiven Tretlagerbereich gibt Auskunft über Stabilität und Steifigkeit bei kurzen Antritten als auch bei längerem Krafteinsatz. Verwindungen sind vom Rahmen her keine zu spüren, die Direktheit endet hier (naturgemäß) eher bei den breiten Reifen.
Die Geometrie ist speziell - wie oben schon erwähnt, wird durch den flachen Lenkwinkel der Vorbau kürzer, dadurch wiederum das Oberrohr länger. Wer mit der Anschaffung eines URS liebäugelt, sollte daher aus meiner Sicht vorher den Händler aufsuchen und dort gemeinsam die Maße besprechen. Blindlings die gleiche Größe wie bei anderen Rädern zu nehmen, kann unter Umständen problematisch werden. Mit meinen 1,94 m Körpergröße und einem langen Oberkörper stellt die Wahl der richtigen Größe bei mir grundsätzlich und fast immer eine Herausforderung dar - ich sitze meistens zwischen den beiden Stühlen "Large" und "X-Large". Die Geschichte mit dem flachen Lenkwinkel kenne ich schon von meinem MTB, daher weiß ich halbwegs, wie ich die veränderten Werte in der Geometrie zu interpretieren habe und was diese für die Position auf dem Rad bedeuten. Das "XL" wäre mir in der Praxis oben etwas zu lang und damit würde ich gefühlt einiges an Wendigkeit verlieren, das "L" ist mir oben fast schon etwas zu kurz, dafür fühlt es sich wendig und agil an. (Zum Glück hat PBike einen schlauen Computer mit meinen Körperdaten, um mir bei der Größenwahl zu helfen!)
Um noch kurz beim Rahmen zu bleiben, dieser hat im Tretlagerbereich viel Bodenfreiheit und bietet damit entsprechend viel Spielraum, um über Dinge drüberzufahren oder sich zumindest nicht das Kettenblatt an Mauern, Steinen oder Wurzeln zu beleidigen.
Die Flaschenhalter im Rahmendreieck sind tief positioniert, damit entsteht viel Raum, der zum Beispiel für eine Rahmentasche genützt werden kann. Und - speaking of Bikepacking - URS macht natürlich auch eine hervorragende Figur im Adventure Modus, wenn man außerdem noch Sattel- und Lenkertasche dazumontiert. Zwei Gewinde im vorderen Bereich des Oberrohrs erlauben außerdem noch, dort eine kleine Zusatztasche mitzuführen. So kann der Mehrtagestrip kommen!
Damit eine Lenkertasche oder -Rolle zwischen den Drops Platz hat, werden von BMC Lenker mit "Flare" verbaut, bei denen also die Lenkerenden nach außen gebogen sind. Weiterer Benefit dieser Lösung ist eine bessere Kontrolle über das Rad in schnellen Offroad-Passagen. Lenker mit Flare sind allerdings auch Geschmackssache, so bin ich beispielsweise kein Fan davon und würde bei meinem URS einen konventionellen Lenker draufschrauben. Mich irritiert die Griffposition eher, als dass ich einen wirklichen Nutzen erkennen könnte. Außerdem bin ich bestimmte Griffpositionen vom Rennrad gewöhnt, die ich so auch auf einem URS beibehalten wollte. Und letztlich sind in Unterlenkerposition auch die Schalthebel nicht mehr so gut erreichbar, da diese ebenfalls entsprechend nach außen geneigt sind.
Ansonsten gibt es allerdings am Cockpit absolut nichts auszusetzen: volle Integration aller Leitungen und Kabel, ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und die schöne Halterung für Wahoos, Gopros, Garmins und sonstiges Zubehör, die bei integrierten BMC-Vorbauten ohnehin immer dabei ist.
Auf den ersten Blick fällt natürlich das Federelement im Hinterbau auf. BMC hat schon einiges an Erfahrung mit dieser Technologie bei seinen Mountainbikes gesammelt. Es gibt keine offiziellen Angaben über den Federweg oder dergleichen, in der Praxis sieht man das Element jedoch in Bewegung und ein paar Millimeter weit wird da jedenfalls gearbeitet. Die tatsächlichen Federeigenschaften zu beurteilen ist aus meiner Sicht nicht wirklich möglich, da ein weitaus größerer Anteil des Komforts im Sattel aus der ewig langen Sattelstütze und den breiten Reifen kommt, wobei man bei letzteren ja zusätzlich auch noch kräftig am Luftdruck schrauben kann. Insgesamt federt der Hinterbau Schläge und Unebenheiten sehr gut ab, auch Roubaix-artige Kopfsteinpflaster-Passagen fühlen sich so etwas weniger schlimm an. Die Tatsache, dass dem Elastomer im Hinterbau keine Dämpfung gegenübersteht, bedeutet, dass es mitunter zu einem minimalen "Hoppeln" kommen kann, vor allem wenn man in einem leichten Gang unterwegs ist und recht dynamisch mit dem Körper mitarbeitet. Verdirbt nicht den Spaß und kommt auch nur in besonderen Konstellationen vor, Abhilfe kann ein anderes Elastomer-Element schaffen, diese sind nämlich in drei unterschiedlichen Härtegraden erhältlich.
Die WTB-Reifen weisen eine Breite von 42 Millimetern auf, während Crosser traditionell (und regelbedingt) meistens "nur" auf 33ern anrollen. Ich persönlich hätte nicht für möglich gehalten, welchen Unterschied diese zusätzlichen 9 Millimeter ausmachen, sowohl was Komfort als auch Grip angeht. Man kann den Luftdruck noch einmal etwas senken, hat damit in geradezu allen möglichen und unmöglichen Situationen ausreichend Haftung und kann auf diese Weise durch Sandfelder, über groben Schotter und alles andere pflügen, was sich einem in den Weg stellt. Aber auch der Speed auf Asphalt war für diese Reifenbreite eine positive Überraschung und bestärkt mich darin, das Rad als Allzweckgerät für alle Untergründe zu sehen.
Einige Gravelbikes am Markt bieten die Möglichkeit, 650B-Laufräder zu montieren, um die Vielseitigkeit noch weiter zu erhöhen. Beim URS ist das nicht der Fall, allerdings sehe ich dafür eigentlich auch keinen wirklichen Grund. Auf etwas Unverständnis stößt bei mir, dass BMC zum einen das Schraubenmaß der Steckachsen von 5mm auf 6mm (Inbus) erhöht hat und gleichzeitig keinen Adapter bzw. Hebel zum Lösen der Schraube mehr beilegt. Für den Reifenwechsel während einer meiner Testfahrten war daher die Einkehr in ein Lagerhaus notwendig, um den entsprechenden Inbus auszuborgen, mein Multitool endet - wie viele andere übrigens auch! - bei einem 5er-Inbus. Bei der Gelegenheit - und hier bin ich tatsächlich zu 100% selbst schuld - möchte ich auch noch erwähnen, dass man auch die entsprechenden Schläuche für 42mm-Reifen mitführen sollte. Die Rückfahrt auf einem 28mm-Schlauch war wenig erbaulich...
Die Schaltung an dem von mir getesteten Topmodell (SRAM XX Eagle AXS Schaltwerk hinten und Red ETAP AXS Schalthebel vorne) funktioniert im Gravel-Einsatz hervorragend. Die Schalthebel von SRAM bieten - im Gegensatz zu Shimano - eine weitaus größere Fläche, sodass man auch mit Handschuhen oder "in der Hitze des Gefechts" einfacher schalten kann. Die zur Verfügung stehenden zwölf Gänge bieten eine große Übersetzungsbandbreite, vor allem das 50er-Ritzel hinten dient entweder als Rettungsring oder als Ermöglicher hoch hinausführender Abenteuer. Wie bei allen 1x-Antrieben sind die Gangsprünge teilweise merklich groß, sodass man ab und zu in die Situation kommt, dass weder der höhere noch der niedrigere Gang so richtig passt. Wer hochalpine Ausflüge oder Reisen mit viel Gepäck im Sinn hat, kann vorne auf ein kleineres Kettenblatt wechseln, damit erhöht sich die Kletterfähigkeit weiter. Schade finde ich, dass nur das Topmodell ab Werk eine größere Übersetzung mitbringt, die höhere Flexibilität würde sicher auch den anderen Modellen zugute kommen.
Als Abschluss sei noch erwähnt, dass URS ein richtiger Eyecatcher ist! Das ist einerseits seiner speziellen Form geschuldet - jeder der genauer hinsieht und vielleicht das Federelement erspäht, erkennt das Spezielle und Ungewohnte an diesem Rad. Ein anderer Faktor ist, dass auf dem gesamten Rad nur ein einziger, zwei Zentimeter großer BMC-Schriftzug angebracht ist, nämlich vorne am Steuerrohr. Keine Logos, keine Schriftzüge und Sticker erzeugen Neugier und Interesse, außerdem bekommt das Rad dadurch ein elegantes und schlichtes Auftreten. Lob an BMC auch für das Selbstvertrauen, nicht das komplette Rad mit Aufschriften zuzukleistern.
Fazit!
In meinen Augen und nach einigen Ausfahrten auf unterschiedlichem Terrain hat BMC hier tatsächlich etwas Neues geschaffen. URS füllt eine Lücke, die man in der Regel zwar erst finden muss, die in meinem persönlichen Radleben allerdings prominent aufklafft und bis jetzt weder durch Crosser, Rennrad oder Hardtail gefüllt werden konnte.
Auf losem und groben Schotter, auf Waldwegen und Fortstraßen spielt URS seine Stärken aus. Viel Grip kommt von den Reifen, der Komfort aus Federung und Sattelstütze verschont den Fahrer und die Fahrerin und die Geometrie lädt tatsächlich zum Spielen ein - diese Böschung hinauf, hier in den Graben hinunter, warum nicht da drüber... Spaß und Radfahren sind in meinen Augen untrennbar verbunden, mit diesem Rad erweitert man die potentiellen Freundenquellen.
Bei größeren Steinen, Wurzeln und Felsen merkt man die Grenzen des Rades, die Wege bleiben natürlich fahrbar aber man ist langsamer unterwegs als mit einem MTB, muss sich gut um die Linienwahl kümmern und die Muskulatur ermüdet schneller. Auf der Straße hingegen - und mit anderen Reifen sowieso - kann URS auch für einen flotte Rennradrunde herhalten.
Foto: Nora Freitag
Was also fahren mit dem URS? Am besten alles, gleichzeitg und abwechselnd, in einem Urlaub, wo man gerne ein Rad für alles mithaben möchte, auf der Langstrecke, mit Gepäck und Satteltaschen, auf dem Weg zum Nachtlager der Dreitages-Tour, auf Forststraßen und Waldwegen, in den Bergen, wo sanfte Schotterwege dominieren, beim Crossrennen, bei der Gruppenausfahrt am Wochenende auf der Straße. "Unrestricted" hat natürlich auch seine Grenzen aber URS lotet sie auf sympathische Weise aus.
Der Preis für URS ist ein beträchtlicher, 3.000 Euro für ein Rad sind viel Geld. Wer schon fünf Räder in seiner Wohnnug stehen hat, wird sich eventuell schwer tun, noch die richtige Nische zu finden. Wer allerdings nach einem Rad sucht, mit dem man im wesentlichen alles machen kann - und zwar alles konkurrenzfähig - der sollte sich URS näher ansehen. Mir haben die Tage mit URS (außer einem kaputten Schlauch) viel Freude bereitet und ich weiß jetzt, mit welchem Rad ich einige meiner Projekte 2020 in Angriff nehmen möchte ;)
Links
Bollé Shifter - Sportbrille mit Korrekturgläsern
Ich werde älter und meine Augen werden schlechter. Stunden vor dem Computer, das Handy in der Hand, wenig Tageslicht - mein Optiker beziffert meine Fehlsichtigkeit mittlerweile mit vier Dioptrien. Brillen trage ich im Alltag seit ich mich erinnern kann, im Spiegel schaue ich fast schon fremd aus, wenn kein Gestell auf meiner Nase prangt.
Ich habe bereits einmal einen Artikel zum Thema Fehlsichtigkeit und Radfahren und den unterschiedlichen Möglichkeiten damit umzugehen, geschrieben. Das meiste davon ist nach wie vor gültig, ich bin noch immer mit einer Mischung aus Brillen und Kontaktlinsen unterwegs - je nach Lust, Laune, Wetter und Outfit. Ich habe allerdings in der Zeit seit dem letzten Blogpost meine Ausrüstung verfeinert. Und noch einen weiteren Schritt habe ich vollzogen, nämlich den einer optisch verglasten Sportbrille.
Sich einen Überblick über die möglichen Modelle zu verschaffen war nicht einfach, die Hersteller räumen dem Thema Korrekturgläser nicht die oberste Priorität ein. Für mich, der eine Brille als selbstverständlich ansieht und an dem Thema nicht vorbeikommt, ist dieser Umstand etwas unverständlich. Ein Blick in die Statistik zeigt, wieviele Menschen Sehbehelfe brauchen. Dass diese Gruppe keinen interessanten Markt darstellt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wer der Statistik nicht glauben möchte, kann sich ja bei der nächsten Gruppenausfahrt einmal umdrehen und durch die Runde blicken - auch dort wird man unterschiedliche Sehbehelfe entdecken.
Die Ausgangslage war folgende:
1. Ich wollte eine dezidierte Sportbrille fürs Radfahren,
2. die Glasfläche sollte möglichst groß sein, um die Augen entsprechend zu schützen,
3. die Optik sollte „in der Scheibe drinnen sein“ - ohne Extra-Konstruktionen, Clip-Ins oder sonstigen Lösungen,
4. die Lichtdurchlässigkeit der Gläser sollte einen möglichst großen Einsatzbereich ermöglichen und
5. die Brille sollte natürlich auch gut aussehen!
Fündig wurde ich schließlich auf der Homepage von Bollé, nachdem mich ein Artikel auf Bikeboard.at darauf aufmerksam gemacht hatte, dass es dort a) ein neues Brillenmodell und b) Verglasung mit Korrekturgläsern gibt. Die Wahl fiel auf das Modell „Shifter“, das auch von den Fahrern von AG2R bei den großen Rennen getragen wird. Die Qual der Wahl hat man zwischen fünf Farboptionen für den Rahmen und ebenfalls fünf Varianten für die Gläser - diese können natürlich wild durcheinander kombiniert werden.
Bei der Wahl der Gläser lohnt es sich, kurz innezuhalten und über einige Dinge nachzudenken. Die Färbung des Glases bestimmt neben technischen Parametern wie Kontrast natürlich auch die Stimmung, wie man seine Umwelt wahrnimmt. Ich persönlich fahre ja lieber in ein weiches, sanftes Licht als in ein kühles und steriles. Dieser Faktor sollte den rein optischen Eigenschaften natürlich nachgeordnet sein, ist aber aus meiner Sicht dennoch nicht zu vernachlässigen. Polarisation hingegen verhindert weitgehend störende Lichtreflexionen und erzeugt ein glasklares und kontrastreiches Bild vor Augen. Die Lichtdurchlässigkeit wird gemeinhin in fünf Kategorien gemessen und beschreibt, wieviel Prozent des einfallenden Lichtes geblockt werden. Je höher hier der angegebene Prozentsatz ist (z.B. Kategorie 4: 92-97%), desto weniger Licht gelangt zum Auge (die Kategorie 4 ist daher auch nur für Schnee, Gletscher und Hochgebirge gedacht und weniger fürs Autofahren). Vierter und letzter Punkt sind selbsttönende Gläser, die - je nach Lichteinfall und -Intensität - ihre Tönung verändern können. Die Technologie dafür ist nicht neu, die Vorteile sind evident: Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit, Komfort. Der Hauptnachteil - die Trägheit beim Wechsel der Tönung - wurde in den letzten Jahren nicht ausgemerzt aber doch stark verbessert.
Meine Entscheidung fällt auf die Phantom-Gläser in „Vemillion Gun“. „Phantom“ bezeichnet bei Bollé den höchsten Standard im Hinblick auf optische Klarheit und Kontrast, außerdem beherrschen sie die oben erwähnte Selbsttönung - in diesem Fall zwischen Kategorie 1 (11% Tönung und damit fast klar) bis Kategorie 3 (47% Tönung bei starkem Sonnenschein). Mein persönliches Ziel ist, mit dieser Brille so viele Anwendungsbereiche wie möglich abzudecken und damit Brillenwechsel oder gar das Mitführen mehrerer Modelle zu vermeiden. Durch die minimale Tönung im Anfangsbereich kann ich die Brille idealerweise auch in der Halle oder zuhause auf der Walze aufsetzen (und damit meine Alltags-Brille entsprechend schonen).
Für die Bestellung von optischen Gläsern ist das Ausfüllen eines Informationsbogens erforderlich, der neben der Anzahl der Dioptrien noch weitere Parameter enthält. Konkret geht es hier um die Position des Auges innerhalb des Brillenglases - die richtige Sehstärke soll ja an der idealen Position auftreten -, außerdem würden hier etwaige Besonderheiten des Auges angeführt werden, die bei der Fertigung der Korrekturgläser berücksichtigt werden müssen. Ich bin mit diesem Bogen schnurstracks zum Optiker meines Vertrauens gegangen, hier selbst etwas zu erfinden oder veraltete Werte einzutragen, macht keinen Sinn.
Warum viele Brillenhersteller davor zurückschrecken, selbst optische Gläser anzubieten, dürfte in der Tatsache liegen, dass es einerseits einiges an Know-How bedarf und zum anderen mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Besonders bei modernen Sport/Rad-Brillen, die mit riesigen Gläsern aufwarten, wird die optische Verglasung zur Herausforderung. Viele Hersteller schränken daher die optische Verglasung auf einige wenige Modelle ein, bei denen beispielsweise das Glas nicht so groß oder die Biegung der gesamten Brille begrenzt ist. Mein Optiker bestätigt, dass eine Verglasung ab einer gewissen Krümmung der Scheibe verbunden mit einer Dioptrienzahl >3.0 tendenziell problematisch ist. Machbar ja, allerdings schrumpft jener Bereich des Glases, der den richtigen Korrekturwert hat, immer mehr und mehr - mit dem Ergebnis, dass die Korrektur nur für einen Bruchteil des kompletten Sichtfelds funktioniert und das geht dann doch irgendwie am ursprünglichen Sinn der Sache vorbei.
Die Lösung besteht im Wesentlichen darin, ein „Glas im Glas“ zu bauen. Optisch korrigiert ist daher ein abgegrenzter Teil rund um das Auge, die Randbereiche der Scheibe sind nicht korrigiert. Das klingt kompliziert, ist aber in der täglichen Handhabung überhaupt kein Problem - wenn man sich nach einigen Tagen daran gewöhnt hat. Anfangs nimmt man noch die unscharfen Ränder wahr, sieht ab und zu einzelne Punkte durch den Randbereich flirren oder ist kurz irritiert, weil man auch am Rand die volle Sehstärke erwartet. Die Korrektur ist jedenfalls ausreichend vorhanden - man kommt also nicht in die Verlegenheit, in bestimmten Kopfpositionen nichts mehr zu sehen, aber gewöhnen muss man sich kurz daran.
An der Qualität und Performance der Gläser ändert sich durch die optischen Einlassungen nichts, auch die Belüftung funktioniert mit den integrierten Schlitzen einwandfrei und makellos. Bei anderen Herstellern ist das zum Beispiel ein potentiell großes Manko, da in die bestehenden Rahmen optische Gläser eingesetzt werden, die allerdings aus Stabilitätsgründen keine Lüftungsschlitze mehr aufweisen - schwierig. Wenn wir schon von Belüftung reden, diese ist bei der Bollé Shifter sehr gut und in manchen Situationen vielleicht auch schon fast etwas zu gut. In bestimmten Positionen bläst es auf der Seite am Rahmen vorbei Richtung Auge - wer hier empfindlich ist, sollte sich vorher auf eine Testfahrt machen.
Die ersten drei Monate mit der Bollé Shifter haben sich hervorragend angelassen. Brille, optische Gläser und Tönung erfüllen die vorher formulierten Erwartungen sehr gut. Auch beim Radeln auf der Rolle ist die Brille im Dauereinsatz - die minimale rötlich/rosa Färbung des Zimmers fällt gar nicht auf.
Mit dem Kunststoffrahmen und den Gläsern wirkt die Brille sehr robust, ich hätte hier keine Bedenken, die Brille auf alle meine Abenteuer mitzunehmen und den Elementen auszusetzen. Im Lieferumfang ist neben einer Art „Brillenpass“ selbstverständlich ein Hardcase dabei, das man mittels Karabiner praktisch an seinen Rucksäcken und Taschen festmachen kann, das Stoffsackerl ist gleichzeitig Putztuch und Aufbewahrungstasche.
Fazit
Ich habe hier eine schicke Radbrille mit optischen Gläsern gefunden, sodass ich mich nicht mehr (ausschließlich) um Wechselbrillen und Kontaktlinsen kümmern muss. Mit den selbsttönenden Gläsern bin ich für mehrere Lichtverhältnisse ausgestattet und kann auch sorgenfrei indoor und in den Abend hineinfahren. Die „unscharfen“ Ränder sind kurze zeit gewöhnungsbedürftig, ab dann schätzt man nur noch die optische Qualität und Zuverlässigkeit. Wer sensibel auf Zug reagiert, sollte jedenfalls probetragen oder sich eines der anderen Modell von Bollé ansehen.
Die Test-Brille wurde von Bollé zur Verfügung gestellt.
Dem Gravel-Trend auf der Spur
Im November werde ich 40 Jahre alt, das befähigt mich – neben einem kurzen Schauer des Älterwerdens - zu einigen spannenden Dingen. 1. Ich kann mich bei schlechten Leistungen zunehmend auf mein Alter ausreden. (Scherz, mach ich natürlich nicht – an meinen schlechten Leistungen sind immer noch Chemtrails und Freimaurer schuld). 2. Ich starte bei Wettbewerben in der ersten Masters-Klasse. Nicht, dass das platzierungstechnisch auch nur irgendeinen Vorteil mit sich bringen würde, aber aus der Allgemeinen Klasse „rausgewachsen“ zu sein, gibt einem manchmal ein Gefühl von altersbedingter Souveränität und Gelassenheit. Und 3. kann ich nun Geschichten mit „Damals…“ und „In meiner Jugend war das ja noch…“ beginnen. Die Gelegenheit zu Letzterem möchte ich heute auch gleich beim Schopf packen und brandaktuell über ein Erkenntnis des vergangenen Wochenendes berichten, das ich im Sattel meines (ehemaligen) Crossers in Osttirol und Kärnten verbracht habe.
Damals…
„In meiner Jugend“ also, bestand mein erster Rad-Kontakt darin, die Serien SLX-Bremsen an meinem Hardtail gegen die rote John Tomac-Sonderedition von Magura zu tauschen, die grünen Reifen (waren das Schwalbe-Modelle?) aufzuziehen, die damals so „in“ waren und mit meinen Freunden nach der Schule den Anninger bei Mödling rauf- und runterzufahren. Es war wohl 1996, das heißt es war gut 15 Jahre her, dass in Kalifornien die Herren Ritchey, Breeze und Fisher ihre damaligen Räder umfunktionierten, den Mount Tamalpais runterfuhren und damit – wohl eher unabsichtlich – eine Bewegung starteten, die in den folgenden Jahren ihren Lauf nahm, zum Boom wurde und Mitte der Neunziger Teenager wie mich dazu brachte, mit dem Rad ins Gelände zu fahren. Der alljährlich im Jänner erscheinende „Bike“-Katalog war die Bibel, aus der man sich die einzelnen Teile für sein oder ihr Traumbike zusammensuchte: Klein Attitude, GT Zaskar oder gar das - damals noch ganz arge - Trek OCLV (?) Full Suspension. Während diese Traum-Konfigurationen damals schon Summen erreichten, die auch heute noch als „stolz“ zu bezeichnen wären, war mein fahrbarer Untersatz ein eher profanes Merida Alu-Bike - Hardtail natürlich, von Federgabeln und dergleichen konnte ich damals nur träumen. Die Reifen hatten Dimensionen, die man heute eher am Crosser findet. Auf den Wald- und Forstwegen bedeutete das, sich die Fahrlinie suchen zu müssen, nicht – mir nichts, dir nichts – einfach über jede Unebenheit drüberradieren zu können, mit dem Körper zu arbeiten, aufmerksam zu sein. Es war eine recht puristische Form des Radfahrens, wenn man sich heutige Maßstäbe vergegenwärtigt.
Gute 20 Jahre später – heute! – schaut der Fahrradmarkt anders aus als damals – fragmentiert bis segmentiert, jedenfalls aber spezialisiert. Nahezu jede Nische ist besetzt, jede Entwicklung wird ausgereizt, ob sie das Zeug zum „Trend“ hat, sogenannte „Standards“ dienen allen möglichen Zwecken, aber sicher nicht jenem, etwas über Grenzen hinweg zu standardisieren. Recht präsent und das seit mittlerweile mehreren Jahren ist das Schlagwort „Gravel“. Was damit im Detail umschrieben ist, bleibt mitunter eher unklar. Fest steht, dass im Geburtsland dieses Trends – den USA – die Rennradfahrer den großen Highways ausweichen wollten und anstelle von pittoresken Land(es)straßen wie bei uns, in den Weiten Amerikas nur geschotterte Wirtschaftswege vorfanden, um dort ihrem Hobby zu fröhnen. Damit man trotzdem wie auf dem schnellen Rennrad unterwegs ist, wurde das Gravel-Rad aus der Taufe gehoben - Rennradgeometrie aber mit mehr Reifenfreiheit. In europäischen Gefilden rümpfte man die Nase und zeigte auf den Crosser, der vor allem im nördlicheren Europa immer schon ein guter Weg war, um quasi rennradartig durch den Winter zu kommen. Schaut man sich allerdings die Geometrie des Crossers an, stößt man (abhängig vom Modell natürlich!) auf Unterschiede: so hat der Crosser ein höher liegendes Tretlager und vor allem einen anderen Lenkwinkel und damit ein anderes Fahrverhalten – enge und eckige Crossrennen verlangen nun einmal mehr Wendigkeit als eine kilometerlange Schottergerade. Der Crosser-Markt der letzten Jahre ist in sich wiederum segmentiert, wobei man grob jene Modelle unterscheiden kann, die (aggressiv) für Cross-Rennen angelegt sind (Specialized Crux, Stevens Super Prestige) oder jene, die eine Art Zwitter zwischen Cross-Rennen und leichten Waldwegen aber auch Long-Distance-Commutern darstellen. Die (negativ formuliert) Unentschlossenheit oder aber (positiv formuliert) Vielseitigkeit dieses Teilbereichs wurde auch durch die unterschiedlichen Optionen deutlich, die diese Räder im Aufbau boten: Ösen für Gepäckträger, Schmutzfänger, 1-fach, 2-fach, mitunter sogar noch 3-fach-Option, unterschiedliche Laufradgrößen – man wollte sich bewusst alle Türen offen halten.
Crosser vs. Gravel
Ich habe meinen Crosser (ein Specialized Crux E1) Ende 2015 gekauft und es im Jahr darauf mit großem Enthusiasmus durch ein paar Cyclocross-Rennen bewegt - mit dabei war die letzte Austragung des Münchner Supercross-Rennens unter der Flagge von Rapha. Die Erfolge waren bescheiden, das Gewand sehr schnell sehr dreckig, der Spaß groß! Den Einsatzbereich dieses Rades aber auf die wenigen Cross-Rennen zu reduzieren, wäre schade gewesen. So war ich im Winter im Schnee, bei gutem und schlechtem Wetter in der Lobau unterwegs, auf Schotter-Radwegen und auf Wirtschaftswegen südlich von Wien. Alle diese Aufgaben bewältigte mein Crosser anstandslos. Nächster Schritt waren die Wege meiner Jugend - auf den Anninger, aufs Eiserne Tor aber auch in den Wienerwald, auf den Bisamberg – wohin mich Strava auch immer führt. Auf diesen Waldwegen und Trails stellte sich ein nostalgisches Gefühl ein – jenes, auf dem Mountainbike meiner Jugend unterwegs zu sein. Die Kraftübertragung aber auch die Spürbarkeit des Untergrunds waren sehr direkt, auch hier musste ich mir genaue Gedanken über die Fahrlinie machen, ohne Federung waren außerdem höhere Aufmerksamkeit und Sorge notwendig. Es machte großen Spaß, ich fühlte mich wie ein Purist, der einem alten Geheimnis auf der Spur ist, einer Erfahrung, wie sie heute nicht mehr bekannt ist. Ich sah mich zu Sätzen verleitet wie „Im Wienerwald kann man doch eh alles mit dem Crosser fahren“, „dafür braucht man kein MTB“ oder „das MTB hebt man sich besser für die richtigen Berge auf“. Dass ich diese Sätze jetzt, da ich auch wieder ein modernes Mountainbike mein Eigen nenne, lautstark und ohne Reue revidiere, liegt daran, dass es mit dem Crosser zwar Spaß gemacht hat, mit dem MTB ist es aber noch um ein Vielfaches lustiger. Und ich rede hier grundsätzlich nicht von Auswüchsen des MTB-Marktes mit >160mm Federweg, sondern von modernen Hardtails oder Fullys mit 100 oder 120mm Federweg. Diese sind gewichtsmäßig leicht und bis ins mittelschwere Gelände meiner Meinung nach die beste Wahl. Für Ausfahrten ins Gelände (im Sinne von Mountainbiken) nehme ich daher mein Mountainbike, der Crosser bleibt dafür in der Ecke stehen.
Parallel dazu sind aber neue Horizonte aufgetaucht – Abenteuer, Bikepacking, Langstreckenfahrten und –rennen. Man hörte Slogans wie „Anyroad“, „Allroad“, „go everywhere – fast“ und „no limits“. Die Industrie witterte einen neuen Trend und zog mit, nahm das neue und noch klein vor sich hin blühende Segment „Gravel“ und zeichnete eine Zukunft, in der man ohne ein Gravel-Touring-Bike nicht mehr existieren kann, im Gegenteil: aus dem Alltag erfolgreich ausbrechen kann, seine Grenzen überwinden und neue Abenteuer erleben wird. Alles reizvolle Ausblicke und ich selbst habe mich liebend gerne in diesen Träumen wiedergefunden und mache das auch heute noch - auch wenn es an der Umsetzung bis jetzt noch gescheitert ist. Teilnahmen an Transcontinental Races oder aber auch „einfache“ Overnighter hier in Österreich sind Dinge, die sich auf allen To-Do Listen gut machen! Gehen wir nochmal zum Anfang des Artikels zurück und damit auch zu den Anfängen des Mountainbikes. Den Fahrer und die Fahrerin von Zwängen zu befreien, die Möglichkeiten zu erweitern, fahren zu können, wo man will – egal auf welchem Gelände, das war das Ziel der Pioniere des Mountainbikes. Mit den ersten Hardtails der 90er-Jahre haben sie dieses Ziel einen Schritt weit erreicht. Die Entwicklung des Mountainbikes ist allerdings in eine Richtung abgebogen, die nicht mehr unbedingt diesem Freiheitsgedanken, sondern vielmehr der Ausarbeitung und Weiterentwicklung des Segments „MTB“ entsprochen hat. Den Freiheitsgedanken findet man heutzutage – auch nach Abzug des üblichen Marketing-Sprechs – viel eher im wachsenden Segment der Gravel- und Adventure-Bikes wieder. Unter diesem Gesichtspunkt ist mir der ganze Trend gleich wieder um ein großes Eck sympathischer, auch wenn es nach wie vor hauptsächlich nach Profit für die Radhersteller riecht. Aber auch hier hege ich eher einen pragmatischen Ansatz und vergönne jedem Hersteller den Erfolg beim Beackern des Marktes, der sich die entsprechenden Gedanken um Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer*innen und Käufer*innen macht.
Wohin geht die Reise?
Ich habe – angesichts in mir geweckter Sehnsüchte – versucht, meinen Crosser so zu adaptieren, dass daraus ein Allzweck-Rad wird, mit dem ich jegliche Unternehmung – vom Alpencross bis zum vollwertigen Rennrad-Ersatz – in Angriff nehmen kann. Lange habe ich getüftelt, welche Laufräder die geeigneten wären, welche Übersetzung Sinn macht, habe Stunden auf die richtige Reifenwahl verbracht, Teile gekauft, Teile getauscht, Teile wieder verkauft und bin an proprietären Laufrad-Standards verzweifelt (Danke, Specialized, dass ihr genau bei meinem Modell ein Jahr lang einen neuartigen Standard ausprobiert habt). Wie schon erkennbar sein dürfte, war das Projekt „Rad-Umbau“ nicht sonderlich erfolgsträchtig. Nicht, dass ich jetzt mit dem Rad nicht fahren kann oder einen enormen Unterschied spüren würde, wen ich das Rad nicht „zweckmäßig“ einsetze, aber ein paar Dinge hätte ich gerne anders gehabt – in erster Linie etwas mehr „Drang nach vorne“ – und das sagt einer, der dem Drang nach vorne normalerweise nicht die oberste Priorität einräumt. Aber die komfortable Sitzposition des Crossers und der steile Lenkwinkel machen ihn im Vergleich zum Rennrad etwas unruhiger und „kürzer“, dementsprechend ist auch die Sitzposition etwas gedrungener.
Das alles kann ich aber erst behaupten und postulieren, seitdem ich mit dem Rad in Osttirol und Kärnten ein paar Runden gefahren bin, die den Einsatz eines Gravel-Rades – so wie ich ihn interpretiere – rechtfertigen. Es waren flotte Runden auf schlechtem Asphalt, auf grob geschotterten Waldwegen, auf weichen Forststraßen, durch trockene Bachbetten und Furten. Das Rennrad wäre hier vermutlich drübergekommen, unbedingt zumuten hätte ich es ihm nicht wollen. Das Mountainbike (der Argumentation von oben folgend: ein leichtes Hardtail) wäre gleichermaßen am falschen Ort gewesen, hier wären die Anforderungen wieder zu gering gewesen, wie mit „Kanonen auf Spatzen zu schießen“… Bei Runden über 100 Kilometer und mehr wäre das MTB auch nicht die richtige Wahl, wenn beispielsweise nur Abschnitte der Route über unbefestigte Wege führen. Und so hatte ich letzte Woche meinen ganz persönlichen Aha-Moment, meine Gravel-Epiphanie, wo ich zum ersten Mal einen (sinnvollen!) möglichen Einsatzzweck eines Gravel-Rades und gleichzeitig die Unzulänglichkeit meiner Umbauversuche erkannt habe.
Und jetzt?
Selbstverständlich soll nach wie vor jedem und jeder unbenommen sein, mit welchem Untersatz man welche Herausforderungen bestreiten will. Mein Geschwurbel soll weder zum Kauf eines Gravel-Bikes (und damit einer potentiell beziehungsgefährdenden „N+1“-Diskussion) anregen noch irgendjemandem vorschreiben, was gut und richtig wäre. Mir persönlich war aber wichtig, für mich selbst einmal Ordnung in meine Gedanken zu bringen, ein paar Dinge zu sortieren und in Relation zu setzen. Vielleicht wird mich ein Hersteller morgen schon mit einem neuen „Standard“ überraschen, der alle meine Gedanken wieder über den Haufen wirft, vielleicht war es aber auch der Startpunkt einer neuen Reise, wer weiß… J
PS: Ich habe leider keinen fotografischen Beweis meiner jugendlichen Ausflüge gefunden, daher darf ich mit einem feuchten Traum aus meiner Jugend schließen (und die tolle Juli Furtado ist auch auf dem Foto zu sehen):
Juli Furtado in den 90ern auf einem GT Zaskar! Quelle